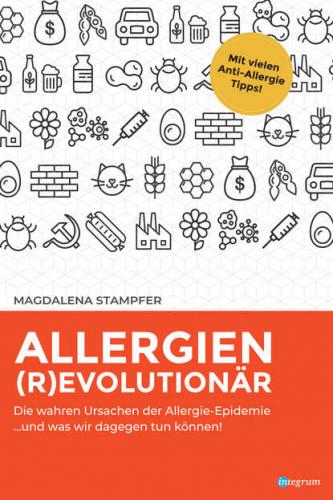Jemand, der wissenschaftlichen Publikationen blind vertraut, erfährt durch die genannte Lektüre einen ähnlichen Schock wie ein Kind, das gerade erfahren musste, dass es kein Christkind gibt. Das Kind kann sich immerhin damit trösten, dass es trotzdem Geschenke geben wird und dass es ja im guten Glauben angeschwindelt wurde. Im Falle der medizinischen Wissenschaft wird uns schmerzhaft bewusst, dass es nur ums Geld geht, dass es stattdessen zahlreiche, nicht abzuschätzende Nebenwirkungen gibt und dass vieles anders ist, als man uns einreden will.
Auf der einen Seite haben wir in der Wissenschaft das Problem, dass mit Zahlen gespielt wird wie in einem Kindergarten mit Legosteinen. Andererseits werden qualitativ hochwertige Studien, die unangenehme Fakten zu Tage bringen, auch nicht gerne gesehen. Die Vorgehensweise ist hier relativ einfach: Am besten ignorieren. Es kann zwar sein, dass ein paar hochrangige Wissenschaftler sich in offenen Briefen um Details streiten, doch die Allgemeinheit und die medizinische Alltagswelt bekommen davon herzlich wenig mit. Bestimmte Gefahren oder Alternativen sind schon seit Jahren oder Jahrzehnten bekannt, die Therapievorschläge bleiben aber gleich. Denn sie haben sich ja wunderbar bewährt – in wirtschaftlicher Hinsicht.
Am Beispiel Krebs: Hat man nach einer Krebstherapie keinen Krebs mehr, so würde man als Durchschnittsbürger diese Behandlungsmethode als erfolgreich einstufen. In der Welt der Statistik wird eine Krebstherapie aber dann als erfolgreich bewertet, wenn der Patient fünf Jahre nach der Diagnose noch lebt, egal ob mit Krebs oder nicht. Stirbt dieser zwei Tage nach Ablauf dieser Frist, zählt er immer noch zu den erfolgreich Behandelten. Nebenwirkungen, weitere Leiden oder therapiebedingte Folgeerkrankungen werden nicht erwähnt, obwohl der Großteil der Krebspatienten daran leidet. In vielen Krebsstudien werden bewusst bestimmte aggressive Krebsarten ausgeklammert, weil davon auszugehen ist, dass bei diesen die Todesrate relativ hoch sein wird. Sucht man sich für seine Forschungen einen vergleichsweise „ungefährlichen“ Krebs, eventuell sogar eine ganz frühe Krebsvorstufe, dann stehen die Chancen weitaus besser, einen Erfolg präsentieren zu können.
Im Journal of Oncology erschien schon vor über zehn Jahren eine groß angelegte Studie mit über 150.000 Krebspatienten über einen Zeitraum von 14 Jahren aus Australien und den USA [22]. Untersucht wurden dabei 22 verschiedene Krebsarten und der Erfolg einer Chemotherapie. Dabei musste man leider feststellen, dass eine Chemotherapie bei dem Fünfjahresüberlebensplan gerade bei 2,1 Prozent der Patienten einen positiven Unterschied ausgemacht hat (das ist allerdings ein Durchschnittswert, bei Hodenkrebs ist die Chemotherapie in 41,8 Prozent der Fälle effektiv, bedingt durch andere, schwierigere Krebsarten kommt aber der ernüchternde Durchschnittswert heraus). Und wie gesagt, diese Patienten mussten nach Ablauf der fünf Jahre gar nicht krebsfrei sein, sondern einfach (noch) nicht tot. Insgesamt waren es von den 150.000 Patienten nur ungefähr 3.000, bei denen der doch trügerische Behandlungserfolg auf die Chemotherapie zurückzuführen war. Eigentlich wäre das längst Grund genug, bei der Behandlung von Krebs umzudenken und andere Methoden zu verwenden. Diese Studie wurde von vielen Onkologen scharf kritisiert und es wurden methodische Mängel unterstellt, wie zum Beispiel jener, dass keine Gewichtung der Krebsarten vorgenommen wurde. Denn einige Krebserkrankungen sind gefährlicher als andere. Ohne die angesprochenen Mängel, so die Kritiker, wäre die Wirksamkeit der Chemotherapie von den knapp über zwei auf sechs Prozent gestiegen. Das ist aber auch nicht berauschend, zieht man die Kosten und auch die Nebenwirkungen einer Chemotherapie in Betracht.
Wenn selbst bei einer lebensgefährlichen Erkrankung wie Krebs derart wenig geändert wird, obwohl vieles dafür spricht, im Behandlungskonzept umzudenken, wie verhält es sich dann erst bei Allergien und Unverträglichkeiten? Allergien sind meist nicht lebensgefährlich, nur im Ausnahmefall könnte durch einen anaphylaktischen Schock ein Menschenleben in Gefahr sein. In den meisten Fällen sind Allergien nur beschwerlich und einschränkend. Und ein gutes Geschäft dazu. Denn ein Allergiker kann sein ganzes Leben lang Patient bleiben, dabei auf Cortison und Antihistaminika angewiesen sein und beim Auftreten der Beschwerden trotzdem zur Arbeit kommen.
Wie wir sehen werden, gibt es auch zum Thema Allergien und Unverträglichkeiten viele wissenschaftliche Erkenntnisse, die für eine ganz andere Herangehensweise an dieses Thema sprechen. Doch dazu müsste man in vielen Bereichen Dinge offenlegen, die man lieber verschweigen möchte.
Schlechte Studien, gutes Essen
Wenn viele Studien irreführend oder schlichtweg falsch sind, andere wiederum ignoriert werden, stellt sich natürlich die berechtigte Frage, worauf die Therapievorschläge und Medikamentenverschreibungen des heutigen schulmedizinischen Alltags beruhen. Dieses Thema ausgiebig zu behandeln ist buchfüllend: Unter dem Titel „Gekaufte Forschung. Wissenschaft im Dienst der Konzerne“ ist ein solches Buch bereits erhältlich [23].
Es beschreibt das enge Geflecht zwischen Konzernen, Hochschulen und der Wissenschaft und zeigt, wie die Geldflüsse Einfluss auf die Inhalte nehmen. Hinzu kommt, dass die meisten Mediziner nach Abschluss des Studiums weiterhin ihre Informationen von den Pharmafirmen erhalten und diesen auch Glauben schenken.
Die Kosten der verpflichtenden Fortbildung wären für Ärzte recht hoch, müssten sie aus eigener Tasche bezahlt werden. Daher springen die Pharmafirmen gerne ein und helfen bei der Organisation der Fortbildungsveranstaltungen. Natürlich nicht immer direkt, denn meist werden die Events von eigenen Agenturen organisiert. Dr. Christiane Fischer, Geschäftsführerin von MEZIS, schätzt die Zahl der gesponserten Fortbildungsveranstaltungen auf 80 Prozent. MEZIS ist die Abkürzung für „Mein Essen zahl‘ ich selbst“, eine Initiative unbestechlicher Ärzte, die gegen den alltäglichen Lobbyismus im Gesundheitswesen vorgeht.
Arztpraxen und Krankenhäuser werden regelmäßig von sogenannten Pharmareferenten besucht, die pharmazeutische Version des Staubsaugervertreters, der an der Haustür läutet und seine Ware verkaufen will. Und eben nicht immer die ganze Wahrheit über die Vor- und Nachteile seines Produktes erzählt. Nicht selten werden die Ärzte dabei zum Essen eingeladen und auf diese gängige Praxis spielt der Name der Initiative an. Beim genussvollen Mahl lässt es sich schließlich noch besser über die Vorteile des neuen, schein-innovativen Medikaments sprechen. Wenn der Großteil der Fortbildungen gesponsert ist, ärztliche Referenten mit überzogenen Honoraren bezahlt und sogar mit vorgefertigten Präsentationen seitens der Industrie bestückt werden, dann hat dies viel mehr mit Werbung als mit Wissensaustausch zu tun.
In den USA sind Ärzte mittlerweile verpflichtet, Zahlungen oder Begünstigungen, die sie von Firmen erhalten, offenzulegen. Der sogenannte Physician Payments Sunshine Act schreibt den Medizinern vor, sämtliche erhaltenen Zahlungen einer Behörde zu melden. In Österreich sieht das Gesundheitsministerium keinerlei Bedarf nach größerer Transparenz, deshalb sind wir hierzulande von einer derartigen Vorschrift noch weit entfernt. Die Höhe der Beträge macht allerdings durchaus Lust auf mehr Information: 105 Millionen Euro sind 2016 von der Pharmaindustrie an Ärzte und Spitäler in Österreich geflossen. Da wäre es schon interessant zu wissen, was mit dem Geld passiert ist.
Durch öffentlichen Druck haben die pharmazeutischen Unternehmen im selben Jahr erstmals ihre Zahlungen an Ärzte und Krankenhäuser veröffentlicht. Ein wenig trotzig ging das Ganze schon vonstatten, es wurde dabei penibel darauf geachtet, die Suche so schwierig und unhandlich wie möglich zu gestalten. Denn um zu überprüfen, ob der Arzt des Vertrauens Zahlungen erhalten hat, müsste man die Websites der über 100 Unternehmen einzeln durchsuchen. Und auf jeder dieser Websites wird die Information aber an einer anderen Stelle veröffentlicht, ganz abgesehen von den mangelhaften Daten und der fehlenden Computerlesbarkeit. Um nach seinem Arzt zu suchen, muss man einiges an Durchhaltevermögen haben. Oder man hat sehr viel Zeit, weil man beispielsweise wegen undurchsichtiger Geldgeschäfte im Gefängnis