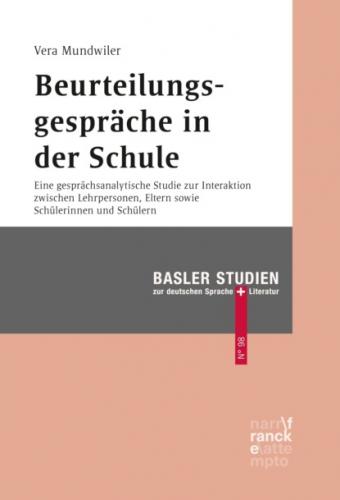Im Folgenden wird Recipient Design zunächst aus konversationsanalytischer Perspektive betrachtet und dann in den Zusammenhang mit den Theorien des Common Grounds und der Positionierung gestellt, welche als konstitutive Merkmale des Konzepts gelten (Kap. 2.2.1). In einem weiteren Teil werden die Praktiken des Recipient Designs unter Einbezug aktueller Untersuchungen dargestellt (Kap. 2.2.2) und abschliessend werden im Hinblick auf das untersuchte Datenmaterial die Spezifika der Mehrparteieninteraktion diskutiert (Kap. 2.2.3).
2.2.1 Recipient Design, Common Ground und Positionierung
Schon in den 1970er Jahren tauchen in den Vorlesungen von Sacks Hinweise auf die Konzeption des Recipient Designs auf, beispielsweise wenn er von der ständigen Fokussierung auf das Gegenüber als „orientation to co-participants“ (Sacks 1995: II: 564 [Spring 1972, lecture 5]) spricht. Später wird der noch heute verwendete Begriff von Sacks, Schegloff und Jefferson (1974: 727) eingeführt und folgendermassen definiert:
By ‚recipient design’ we refer to a multitude of respects in which the talk by a party in a conversation is constructed or designed in ways which display an orientation and sensitivity to the particular other(s) who are the co-participants.
Recipient Design verweist also auf eine Vielzahl an Ressourcen und Praktiken, die im Gespräch eine Orientierung an den Gesprächsteilnehmenden aufzeigen. Es bleibt bei dieser Definition jedoch weitgehend unklar, was unter einer Orientierung an den Gesprächsteilnehmenden („orientation and sensitivity to the particular other(s)“) genau zu verstehen ist und wie sie untersucht werden kann.
Eine Orientierung an den Gesprächsteilnehmenden bedingt, dass Sprechende einschätzen können, in Bezug auf welche Aspekte der Redebeitrag auf eine Person zugeschnitten werden muss. Diese Einschätzungen können je nach Bekanntheitsgrad ad hoc oder erfahrungsbasiert gebildet werden. Jedoch kann eine Orientierung an den Anwesenden nur auf mehr oder weniger zutreffenden Annahmen basieren, die von Sprechenden über die Rezipierenden getroffen werden (vgl. Bergmann 1988: 41f.; Deppermann & Blühdorn 2013: 8f.; Hitzler 2013: 112f.). Bei der weiteren Ausdifferenzierung des Begriffs müssen gemäss Deppermann und Blühdorn (2013: 8f.) sprachlich-interaktive, kognitive und ontologische Aspekte betrachtet werden.
Recipient Design bezeichnet sprachlich-interaktive Praktiken, die von Sprechenden verwendet werden, um sich an erwartbaren Merkmalen der Gesprächsteilnehmenden zu orientieren. Diese Merkmale sind nur erwartbar, denn sie stützen sich auf Annahmen über „Wissen, Motive, Emotionen, Einstellungen, Erwartungen, wahrscheinliche Reaktionen etc.“ (Deppermann & Blühdorn 2013: 8) der Gesprächsteilnehmenden. Die interaktive Zuschreibung von Eigenschaften steht in engem Zusammenhang mit dem Konzept der Positionierung und wird insbesondere unter dem Aspekt der Fremdpositionierung betrachtet (vgl. z.B. Deppermann & Blühdorn 2013: 8; Hitzler 2013). Schmitt und Knöbl (2013: 267f.) weisen jedoch auf die „strukturelle Reflexivität“ von Positionierungsaktivitäten hin:
Der eine Interaktionsbeteiligte repräsentiert durch sein recipient design nicht nur sein Gegenüber in der Interaktion in der Weise, dass er ihn/sie in interaktiv und sozial relevanter Weise positioniert. Der ‚Designer’ positioniert sich selbst in unmittelbar vergleichbarer Weise und macht auch sich selbst – vielleicht sogar in erster Linie – als spezifischen Teilnehmer mit bestimmten sozialen, kulturellen und interaktiven Besonderheiten sichtbar.
Aufgrund der Eigenschaft dieser doppelten Positionierungsleistung1 schlagen die Autoren dann auch vor, den Begriff participant design2 einzuführen und jeweils in der Analyse zu spezifizieren, welche Aspekte als fremdbezogen oder selbstbezogen betrachtet werden. Auch wenn diese begriffliche Neubestimmung durchaus überzeugend ist, soll in dieser Arbeit dennoch der Kontinuität zuliebe der in der Forschungsliteratur verankerte Begriff des Recipient Designs beibehalten werden. Die Konzeption der strukturellen Reflexivität von Positionierung und demnach von Recipient Design wird aber im Rahmen der Analysen weiterverfolgt (vgl. Kap. 2.4 zur Positionierung).
Weiter muss beachtet werden, dass es sich bei getroffenen Annahmen über das Gegenüber um kognitive Entscheidungen handelt, die durch ein entsprechendes Recipient Design erst sichtbar werden. Deppermann und Blühdorn (2013: 9) erfassen diesen Aspekt des Recipient Designs unter dem Begriff Partnermodell, da es sich um gegenseitige Partnerannahmen handelt, die sich auf die Ausgestaltung der Gesprächsbeiträge auswirken (können). Die Autoren betonen, dass nicht alle Annahmen, die über die Gesprächsteilnehmenden getroffen werden, auch in der Interaktion ersichtlich werden. Bei der Analyse ist also nur der Blick auf die tatsächlichen Praktiken des Recipient Designs möglich, die durch ihre indexikalische Funktion auf die Annahmen verweisen.
Unter dem ontologischen Aspekt diskutieren Deppermann und Blühdorn (2013: 9) schliesslich die Problematik der Perspektivität des Partnermodells. So handelt es sich bei den Annahmen immer um subjektive Zuschreibungen vonseiten der Sprechenden, die sich im besten Fall mit den Selbstzuschreibungen von Rezipierenden decken. So kommen Deppermann und Blühdorn (2013: 9) zum folgenden Schluss:
Ob das Partnermodell korrekt ist bzw. vom Partner akzeptiert wird, kann oft nur im Zuge interaktiver Aushandlung geklärt werden. Das Partnermodell ist nicht statisch, sondern wird im Lauf der Interaktion permanent aktualisiert.
Für Analysen des Recipient Designs bedeutet das also, dass wir sprachliche Praktiken untersuchen können, die Interpretationen der Annahmen und Zuschreibungen von Sprechenden über Rezipierende zulassen. Da die Annahmen interaktiv ausgehandelt werden und von den Gesprächsteilnehmenden gegebenenfalls akzeptiert oder abgelehnt werden, muss von ständig wechselnden Zuschreibungen ausgegangen werden. Schmitt und Knöbl (2013: 248) sprechen im Zusammenhang mit der interaktiven Aushandlung des Recipient Designs auch von der „sequenzielle[n] Intersubjektivierung“ und beobachten, dass sich das Recipient Design in gemeinsam ausgehandelten Sequenzen über drei Phasen hinweg manifestiert, nämlich über Angebot, Reaktion und Ratifikation.
Wenn davon ausgegangen wird, dass Gesprächsbeiträge jeweils ausgehend von eigenen Annahmen über das Gegenüber gestaltet werden, so geht es beim Recipient Design in anderen Worten darum, Annahmen zum gemeinsamen Wissen zu bilden und laufend zu aktualisieren. Dieses gemeinsame Wissen ist auch unter dem Konzept common ground oder grounding bekannt (vgl. Clark 1996; Clark & Brennan 1991; Clark & Schaefer 1989; Stalnaker 2002) und lässt sich mit der Konzeption des Recipient Designs vergleichen (vgl. zum Zusammenhang von Recipient Design und Common Ground auch Deppermann & Blühdorn 2013: 9f.). Auch Clark (1996: 92) erkennt die Problematik des tatsächlichen und des nur vorausgesetzten Wissens:
Everything we do is rooted in information we have about our surroundings, activities, perceptions, emotions, plans, interests. Everything we do jointly with others is also rooted in this information, but only in that part we think they share with us. The notion needed here is common ground.
Aus dieser Einführung zum Common Ground geht deutlich hervor, dass wir uns bei Interaktionen (als Form einer gemeinsamen Aktivität) grundsätzlich auf das als geteilt angenommene Wissen verlassen und dabei keine Aussage über tatsächlich vorhandene Wissensbestände beim Gegenüber machen können. Gemäss Jucker und Smith (1996: 2) umfasst Common Ground einerseits das vermutete gemeinsame Wissen und andererseits auch die lokalen Entscheidungen bei der sprachlichen Ausführung, wie z.B. die Einschätzung, welche Referenzen im gegebenen Kontext für die Rezipierenden klar und unmissverständlich sind. Beispielsweise reicht in einer denkbaren Situation in einem Beurteilungsgespräch die Namenreferenz Frau Schütz aus, wenn allen Anwesenden bekannt ist, wer Frau Schütz ist. Sollte dieses Wissen jedoch nicht allen bekannt sein, müsste weiter präzisiert werden, dass es sich bei Frau Schütz z.B.