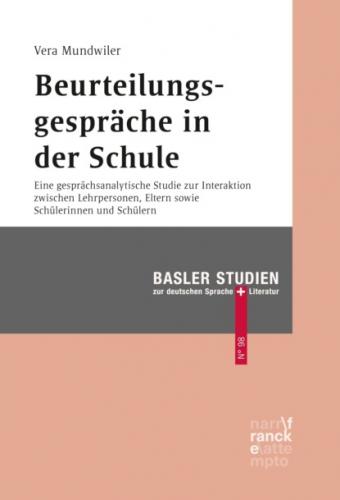Aufgrund der Datenlage und der bisherigen Forschung sind die folgenden Forschungsinteressen zentral für die vorliegende Arbeit:
Insgesamt herrscht im Bereich der Kommunikation zwischen Lehrpersonen, Eltern und SchülerInnen ein Mangel an (gesprächsanalytischen) Studien, die sich auf authentische Gesprächsdaten stützen. Wenn auch in den letzten Jahren ein steigendes Interesse an dem Gesprächstyp zu verzeichnen ist, bleiben viele Fragen noch unbearbeitet. Insbesondere die Anwesenheit von SchülerInnen in Beurteilungsgesprächen sowie deren Einfluss auf die Interaktion wurde noch nicht hinreichend betrachtet.
Ziel und Anspruch dieser Forschungsarbeit ist es, am Beispiel von Beurteilungsgesprächen neue Erkenntnisse zu Beteiligungsstrukturen und Positionierungsaktivitäten in der Kind-Erwachsenen-Interaktion zu erarbeiten. Dabei interessieren insbesondere die spezifischen Design-Aktivitäten (vgl. Schmitt & Knöbl 2014) vonseiten der Erwachsenen, welche einerseits eine Orientierung am anwesenden Kind oder Jugendlichen aufzeigen oder aber eine Involvierung ebendieser begünstigen. Es interessiert dabei die Frage, welche Interaktionsmöglichkeiten den anwesenden SchülerInnen geboten werden und wie diese von denen genutzt werden können.
Im Folgenden lege ich dar, welche spezifischen Bereiche in der vorliegenden Arbeit fokussiert werden.
1.3 Aufbau der Arbeit
Nachdem in Kapitel 1 der Forschungsbereich des schulischen Beurteilungsgesprächs abgesteckt wurde und Begriffsbestimmungen, bisherige Forschungsergebnisse sowie die eigenen Forschungsinteressen dargelegt wurden, geht es in Kapitel 2 um die theoretische Einbettung der Forschungsarbeit. Zuerst wird die Gesprächsanalyse als methodischen und theoretischen Bezugsrahmen vorgestellt (Kap. 2.1). Dann geht es um interaktive und kooperative Grundprinzipien der mündlichen Interaktion und in diesem Zusammenhang um das konversationsanalytische Konzept Recipient Design (Kap. 2.2). Daraufhin werden Aspekte der interaktiven Beteiligung diskutiert (Kap. 2.3). Beteiligungsrollen können nach Goffman (1981) sowohl aufseiten der Rezipierenden als auch aufseiten der Produzierenden einer Äusserung weiter ausdifferenziert werden. So muss beispielsweise zwischen adressierten und nicht-adressierten Rezipierenden unterschieden werden. Und bei der Produktion einer Äusserung gibt es verschiedene Situationen, in denen eine weitere Differenzierung des Begriffs SprecherIn nötig wird, beispielsweise wenn eine Person durch direkte Redewiedergabe das Gesagte einer anderen Person wiedergibt. Zudem geht es um Steuerungsaktivitäten, welche die Beteiligung einzelner Personen beeinflussen können. Und schliesslich werden theoretische Überlegungen zur Identitätskonstruktion und zur Positionierung vorgestellt (Kap. 2.4). Es geht dabei zuerst allgemein um die Konstruktion von Identität(en), dann um Konzepte der sozialen Kategorisierung, schliesslich um die Selbst- und Fremdpositionierung und damit verbunden auch um die Selbst- und Fremdbeurteilung.
In Kapitel 3 wird das methodische Vorgehen, welches sich an den Grundprinzipien der ethnomethodologischen Konversationsanalyse orientiert, detailliert dargelegt und reflektiert (Kap. 3.1). Zudem wird das erhobene Korpus vorgestellt (Kap. 3.2). Es handelt sich dabei um Audioaufnahmen von authentischen Beurteilungsgesprächen auf unterschiedlichen Schulstufen. Alle Gespräche werden zur Orientierung kurz inhaltlich zusammengefasst und mithilfe weiterer Kontextinformationen beschrieben.
Nun folgen die fünf Analyseteile zu ausgewählten Aspekten. In Kapitel 4 werden die Eröffnungs- und Beendigungssequenzen der Gespräche analysiert. Dadurch gewinnen wir einen Einblick in den Aufbau und die Ziele der Gespräche. Gleichzeitig zeigt die Analyse der Gesprächsränder, wie die Gesprächsbeteiligten sich in dieser Interaktion gleich zu Beginn gewisse (Beteiligungs-)Rollen zuweisen. Diese Themenkomplexe werden in eigenen Teilen weiter ausgearbeitet.
In Kapitel 5 folgen erste Analysen zu Positionierungsaktivitäten und sozialen Rollen. Es geht dort insbesondere um die Positionierung von Lehrpersonen und Eltern als (Ko-)Lehrpersonen (Kap. 5.1), als Eltern und Erziehende (Kap. 5.2) sowie als (ehemalige) Lernende (Kap. 5.3). Die Positionierungen machen ein allgemeines Streben nach Symmetrien in der Interaktion sichtbar, was sich gerade auch bei den Positionierungen bei elternseitiger Kritik zeigen lässt (Kap. 5.4). Durch die beobachteten Positionierungen lässt sich zeigen, wie die Beteiligten darum bemüht sind, das schulische Beurteilungsgespräch gemeinsam als inter-institutionelle Kommunikation zu etablieren.
Der Fokus der Analysen in Kapitel 6 liegt auf der interaktiven Herstellung von Beteiligung in der Interaktion. Es kann an Gesprächsdaten gezeigt werden, wie die Beteiligung von allen Anwesenden aktiv mitgestaltet wird und das Zusammenspiel verschiedener Steuerungsaktivitäten und Design-Aktivitäten (vgl. Schmitt & Knöbl 2014) die Inklusion und Beteiligung der Kinder bzw. Jugendlichen beeinflusst. Zuerst werden Beteiligungsstrukturen bei expliziter Adressierung diskutiert (Kap. 6.1) und schliesslich werden die häufig verwendeten Verfahren der wechselnden und ambigen Referenzen genauer auf die Implikationen hin untersucht (Kap. 6.2).
In Bezug auf die Beteiligungsstrukturen sowie die Positionierungs- und Beurteilungsaktivitäten zeigt sich die animierte Rede (vgl. Ehmer 2011) als besonders funktional in Beurteilungsgesprächen mit anwesenden SchülerInnen. Ich verstehe die animierte als spezifische Design-Aktivität und bespreche die Funktionen und Kontexte gesondert in Kapitel 7, um vertieft darauf eingehen zu können. Es geht dabei im Wesentlichen um Selbst- und Fremdpositionierungen und indirekte sowie implizite Bewertungen am Beispiel von imaginierten Identitätsmerkmalen.
Zuletzt wird in Kapitel 8 die Praxis der Selbstbeurteilung kritisch diskutiert. In einigen Schulen füllen die SchülerInnen vor den Beurteilungsgesprächen schriftliche Selbstbeurteilungsbögen aus und bringen diese zu dem Gespräch mit. Diese Selbstbeurteilungen werden in den Gesprächen sehr unterschiedlich gewichtet und es wird der Frage nachgegangen, wie die teilweise divergierenden Selbst- und die Fremdbeurteilungen von den Beteiligten ausgehandelt werden.
In Kapitel 9 werden schliesslich die Ergebnisse resümiert und es folgt ein Ausblick auf zukünftige Forschungstätigkeiten im Bereich von Beurteilungsgesprächen in der Schule. Dabei werden einerseits Forschungsdesiderata formuliert, die sich auf die (gesprächsanalytische) Erforschung von Beurteilungsgesprächen bezieht. Andererseits werden erste Überlegungen zur Relevanz der Forschungsergebnisse für (angehende) Lehrpersonen gemacht. Dabei geht es noch nicht um die Ausarbeitung von Schulungsangeboten, da dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, aber es werden Möglichkeiten der Angewandten Gesprächsforschung angedacht.
2 Konversationsanalyse und darüber hinaus
„A speaker should, on producing the talk he does, orient to his recipient.“
(Sacks 1995: II: 438 [Fall 1971, lecture 4])
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit mündlichen Gesprächsaufnahmen und lässt sich grundsätzlich der Forschungstradition der ethnomethodologischen Konversationsanalyse und damit der qualitativen Sozialforschung zuordnen (vgl. Deppermann 2008a: 10). Meine Studie orientiert sich hauptsächlich an der Konversationsanalyse, richtet sich jedoch in einigen Punkten nach den Anpassungen von Deppermann (2008a), der durch den Begriff Gesprächsanalyse seine methodischen Anpassungen in Abgrenzung zur ursprünglichen Konversationsanalyse anzeigt.1 Beispielsweise spricht sich Deppermann (2000; 2008a: 10) entgegen dem konversationsanalytischen Forschungsinteresse für den Einbezug von ethnografischem Datenmaterial aus (vgl. dazu Kap. 3.1).
Im Folgenden werden zuerst die Vorgehensweisen der Gesprächsanalyse sowie grundlegende Erkenntnisse der Gesprächsforschung vorgestellt (Kap. 2.1). In den weiteren Teilen werden theoretische und methodische Ansätze diskutiert, die sich als besonders zentral und fruchtbar für die Analyse zeigen. Es handelt sich dabei um die grundlegende Interaktivität und Ausrichtung an den Rezipierenden (Kap. 2.2), um Beteiligungsstrukturen in der Interaktion (Kap. 2.3) sowie um Theorien zu Identität(en) und Positionierungen im Gespräch (Kap. 2.4).
2.1 Gesprächsanalyse
Der theoretische und methodische Rahmen der vorliegenden Untersuchung wird durch die ethnomethodologische Konversationsanalyse gegeben, wie sie in den 1960er Jahren entwickelt und massgeblich