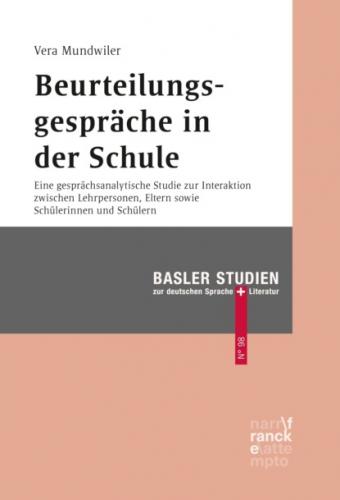Während es in der breiter soziologisch ausgerichteten Ethnomethodologie um jegliche soziale Prozesse geht und methodisch mehrheitlich mit teilnehmender Beobachtung oder Garfinkels berühmten breaching experiments2 gearbeitet wurde (vgl. Hutchby & Wooffitt 2008: 28f.), liegt der Fokus der Konversationsanalyse im Speziellen auf der sprachlichen Interaktion. Um genaues Hinhören und mehrfaches Abspielen zu ermöglichen, wurde seit den Anfängen der Konversationsanalyse mit Audio- und später dann auch Videodaten gearbeitet (vgl. z.B. Hutchby & Wooffitt 2008: 69ff.). Was die Interessen der Gesprächsanalyse sind, wird sehr treffend bei Deppermann (2008a: 9, Hervorhebung im Original) erläutert:
[Die Gesprächsanalyse] will wissen, wie Menschen Gespräche führen. Sie untersucht, nach welchen Prinzipien und mit welchen sprachlichen und anderen kommunikativen Ressourcen Menschen ihren Austausch gestalten und dabei die Wirklichkeit, in der sie leben, herstellen. Diese Gesprächswirklichkeit wird von den Gesprächsteilnehmern konstituiert, d.h. sie benutzen systematische und meist routinisierte Gesprächspraktiken, mit denen sie im Gespräch Sinn herstellen und seinen Verlauf organisieren.
Das Ziel der Gesprächsanalyse ist es also, die verschiedenen kommunikativen Ressourcen und Gesprächspraktiken von Gesprächsteilnehmenden zu untersuchen, um besser zu verstehen, wie Gespräche verlaufen. Wie auch bei der Ethnomethodologie liegt das Erkenntnisinteresse darin nachzuvollziehen, wie Bedeutung und Sinn im Gespräch hergestellt werden und folglich wie die Gesprächsteilnehmenden diese bedeutungsvolle Gesprächswirklichkeit konstituieren und interaktiv aushandeln. Diese gemeinsame Herstellung oder Hervorbringung der Gesprächsrealität, welche Garfinkel (1967: 11) als accomplishment oder achievement bezeichnet, gilt als zentraler Grundgedanke der ethnomethodologischen Konversationsanalyse (vgl. z.B. Gülich & Mondada 2008: 13; Stukenbrock 2013: 222). Der hergestellte Sinn wiederum kann in der Analyse nachvollzogen werden, indem beobachtet wird, wie die Teilnehmenden interaktiv auf das Gesagte reagieren und Bezug nehmen und dadurch den weiteren Verlauf prägen. Die Gesprächsbeteiligten orientieren sich dabei an der grundlegenden Sequenzialität (vgl. Stukenbrock 2013: 231) bzw. Prozessualität (vgl. Deppermann 2008a: 8) von Gesprächen, d.h. an zeitlich nacheinander realisierten Gesprächsbeiträgen. Ausgehend von der sequenziellen Organisation von Gesprächen versteht sich die konversationsanalytische Methode auch als Sequenzanalyse (vgl. Kap. 3.1.3).
Wichtig ist bei der Analyse von Gesprächen, dass nicht die Frage im Zentrum stehen soll, welche Beweggründe eine Person zur einen Sprachhandlung und nicht zur anderen motivieren, sondern die Frage nach den verwendeten Ressourcen und Praktiken, die zur Ausgestaltung von Sinn und Bedeutung beitragen. So hält Sidnell (2011: 18) fest: „Rather than asking what is going on in the speaker’s head (or mind, or brain) we should be asking […] what is being accomplished in interaction by speaking in just this way“. Deppermann (2013a: 35) spricht in diesem Zusammenhang auch vom mentalen Agnostizismus und bringt so dezidiert zum Ausdruck, dass in der Gesprächsanalyse nur die beobachtbare Interaktion im Fokus des Interesses steht und alle Erklärungen und Interpretationen in der Interaktion selbst verankert sein müssen.
Welche Prämissen der Gesprächsanalyse zugrunde liegen und das analytische Vorgehen massgebend beeinflussen, soll in Kapitel 2.1.1 dargestellt werden. In Kapitel 2.1.2 werden einige grundlegende Prinzipien der Gesprächsorganisation vorgestellt, die sich auf Erkenntnisse aus Studien stützen und die in späteren Analysen vorausgesetzt und nicht mehr speziell eingeführt werden.
2.1.1 Prämissen der ethnomethodologischen Konversationsanalyse
Eine Grundannahme der ethnomethodologisch ausgerichteten Gesprächsanalyse betrifft die Ordnung im Gespräch, die als Ausspruch „order at all points“ (Sacks 1995: I: 484 [Spring 1966, lecture 33]; Sacks 1984: 22) bekannt ist und besagt, dass jedes Detail in der Interaktion seine Bedeutung hat. So erklärt Heritage (1984a: 241) „no order of detail can be dismissed, a priori, as disorderly, accidental or irrelevant“. Pausen und Stimmveränderungen haben also denselben Stellenwert wie semantisch reiche Wörter. Die Prämisse bedeutet, dass Menschen im Gespräch Sinn und Bedeutung aus dem Gesagten machen und deshalb eine grundlegende Ordnung vorhanden sein muss. Gerade Phänomene wie Reparaturen zeigen auf, wie die erwartete, ‚normale’ Ordnung wäre, indem durch den Fokus auf ‚fehlerhafte’ Bestandteile eine Abweichung von der Norm gekennzeichnet wird (vgl. Sidnell 2013: 87). Wenn man davon ausgeht, dass kein Detail in der Analyse ausser Acht gelassen werden darf, da es vielleicht bedeutungstragend ist und Aufschluss über die tatsächlichen Praktiken zulässt, wird klar, dass die Analyse von Gesprächen unersättlich weitergeführt werden kann. Es ist also wichtig, zwar einerseits offen an die Daten heranzutreten und möglichst alle Interpretationswege zu bedenken, andererseits jedoch auch klare Fokussierungen von Einzelphänomenen anzustreben, um nicht in der Fülle der Details die Grundstrukturen der Gespräche zu vernachlässigen.
In direktem Zusammenhang mit der Prämisse order at all points kann auch die induktive, materialgestützte Vorgehensweise verstanden werden. Wenn nämlich alle Details im Gespräch potenziell bedeutungskonstitutiv sind, so müssen all diese Details in den Daten selbst betrachtet werden. Es ist demnach bezeichnend, dass in der Gesprächsanalyse die Fragestellungen am Material selbst entwickelt werden und nicht von Hypothesen ausgehend die Daten analysiert werden (vgl. z.B. Deppermann 2008a: 21; Sidnell 2011: 28f.).
Allerdings muss die Ansicht der rein induktiven Methode m.E. ein wenig relativiert werden. Wenn Heritage (1984a: 238) sagt, „original data are neither idealized nor constrained by a specific research design or by reference to some particular theory or hypothesis“, so kann dieser strikten Forderung kaum nachgekommen werden. Zwar wird hier deutlich gemacht, dass grundsätzlich nicht Theorien und Hypothesen als Ausgangspunkt der Analyse genommen werden, sondern die Daten jederzeit als primären Bezugspunkt betrachtet werden sollen. Damit setzt sich die Gesprächsanalyse methodisch gegen andere Ansätze der Linguistik ab, in denen zu Beginn klare Hypothesen eingefordert werden. Allerdings wird es kaum möglich sein, die Augen vor bereits existierenden Studien zu verschliessen und ein Projekt ohne Forschungsdesign zu planen. Auch das mehrfach postulierte „unmotivated looking“ (Psathas 1995: 45; vgl. auch Hutchby & Wooffitt 2008: 89) ist problematisch, wenn man bedenkt, dass alleine die Wahl, welche Daten aufgenommen werden oder wie die Aufnahmegeräte positioniert werden, eine gewisse Motivation für die Fokussierung von bestimmten Kontexten und Phänomenen zeigen. So behaupte ich, dass sich bei der Mehrheit der gesprächsanalytischen Projekte eine gewisse Erwartungshaltung nicht komplett vermeiden lässt. Beispielsweise wurde das Forschungsdesign der vorliegenden Arbeit durch die Annahme motiviert, dass es sich beim spezifischen Kontext des schulischen Beurteilungsgesprächs um einen interessanten und potenziell emotional geladenen Gesprächstyp handelt, bei dem also die Beziehungsebene und die Rollenaushandlung von Interesse sein könnte. Trotzdem wurden keine konkreten Hypothesen aufgestellt, die es zu prüfen galt, sondern die weitere Arbeit war zunächst ganz im Sinne der Gesprächsanalyse so organisiert, dass die Daten für sich betrachtet wurden. Die am Ende tatsächlich analysierten Phänomene sind also durchaus materialbasiert zum Fokus geworden und so war beispielsweise eine Vertiefung der Adressierungsmechanismen vor Sichtung der Daten nicht vorgesehen. Jedoch müssen diese induktiv gewonnenen Erkenntnisse