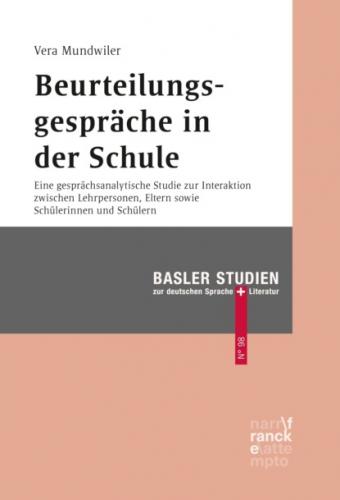Wie die Definitionen zeigen, umfasst Recipient Design als Konzept sowohl die Aushandlung von Wissensbeständen als auch die Zuschreibung von Identitäts- und Beziehungsmerkmalen. Dadurch steht das Konzept des Recipient Designs den Theorien des Common Grounds und der Positionierung sehr nahe.
Es stellt sich hier abschliessend die Frage, ob es sich beim Recipient Design um eine grundsätzliche Charaktereigenschaft eines jeden Gesprächsbeitrags handelt oder ob eine Äusserung auch ‚nicht recipient designed’ sein kann. In der ursprünglichen Konzeption des Begriffs wird diese Frage offen gelassen, allerdings wird in derselben Publikation vermerkt, dass Recipient Design „perhaps the most general principle which particularizes conversational interactions“ (Sacks, Schegloff & Jefferson 1974: 727) sei. Auch Deppermann (2008a: 81) bezeichnet Recipient Design als nicht vermeidbare Aufgabe bei jedem Gesprächsbeitrag. Diesen Feststellungen sowie den Überlegungen von Schmitt und Knöbl (2013) schliesse ich mich an und verstehe Recipient Design als grundlegendes Prinzip mündlicher Kommunikation. Demnach sind Gesprächsbeiträge „nicht-hintergehbar recipient designed“ (Schmitt & Knöbl 2013: 247),3 da sie in der Interaktion entstehen und dadurch immer an jemanden gerichtet sind. Es sollte also nicht in erster Linie um die Frage gehen, ob ein Gesprächsbeitrag ‚recipient designed’ ist oder nicht, sondern es handelt sich beim Recipient Design um eine mögliche Analyseperspektive4 auf ein Phänomen, welches theoretisch in jedem Gespräch untersuchbar wäre.
2.2.2 Lokale Ausrichtung am Gegenüber
Im Folgenden gilt es zu klären, welche Praktiken des Recipient Designs bzw. welche Design-Aktivitäten (Schmitt & Knöbl 2014: 95ff.) von den Gesprächsteilnehmenden eingesetzt werden. Schmitt und Knöbl (2014: 96) führen den Begriff der Design-Aktivitäten ein, um zwischen den „einzelnen lokalen, im Zweifelsfall gut isolierbaren Aktivitäten mit Design-Relevanz“ und dem „Recipient Design als kohärentes und konsistentes Gesamt einzelner lokaler Design-Aktivitäten“ zu differenzieren. Demnach sind es die konkreten Design-Aktivitäten, die sich in der Interaktion im spezifischen Kontext untersuchen lassen. Das Recipient Design hingegen ist u.a. das Ergebnis dieser dynamischen, situierten Aktivitäten und umfasst eine „ganzheitliche Konzeption des Anderen mit unterschiedlichen sozial-kategorialen Facetten und Implikationen“ (Schmitt & Knöbl 2014: 96). Die Ausprägung des Recipient Designs lässt sich somit erst auf einer Makroebene, und dies jeweils fallbezogen, beantworten.
In der ursprünglichen Konzeption des Recipient Designs von Sacks, Schegloff und Jefferson (1974: 727) bleiben die Ausführungen in Bezug auf die relevanten Praktiken mit der Formulierung „a multitude of respects“ noch sehr allgemein. In den weiteren Ausführungen wird – allerdings erst unspezifisch – darauf verwiesen, dass sich die Hinwendung zu den Rezipierenden auf verschiedenen Ebenen der Ausgestaltung des Turns aufzeigen lässt, wie beispielsweise bei der Wortwahl, der Abfolge von Äusserungen sowie der Art und Weise der Gesprächseröffnung und -beendigung. Welche spezifischen Praktiken hierbei eine Rolle spielen, zeigen die im Folgenden vorgestellten Forschungsarbeiten, die sich mit Aspekten des Recipient Designs beschäftigt haben.
Frühe Untersuchungen zum Recipient Design beschäftigen sich insbesondere mit Personenreferenzen (vgl. z.B. Goodwin 1981; Lerner 1996a; Malone 1997; Sacks & Schegloff 1979; Schegloff 1996a). So kann je nach Verwendung der Referenzen angezeigt werden, wer aktuell mit einer Äusserung erreicht werden möchte, in welchem Verhältnis Personen zueinander stehen und wem welche Beteiligungsrollen zugestanden werden (vgl. z.B. Malone 1997: 42ff.).
Weiter zeigt Maynard (1991a; 1991b; 1992; 1996; 2003) in seinen Studien zur Übermittlung guter und schlechter Nachrichten im medizinischen Bereich, wie ÄrztInnen in mehrschrittigen Verfahren die Perspektive der Rezipierenden bearbeiten. Durch diese Perspektivenübernahmen oder sogenannten perspective display series beziehen sie die Sicht der Rezipierenden im Design ihrer nachfolgenden Nachricht mit ein. Ebenfalls im Zusammenhang mit verzögertem Überbringen von Nachrichten und dadurch starker Ausrichtung am Gegenüber, lassen sich schliesslich Schegloffs (1980) frühe Untersuchungen zu preliminaries to preliminaries betrachten. Und Pomerantz (1984) untersucht in ihrem vielrezipierten Aufsatz, dies jedoch ohne Bezugnahme auf das Konzept des Recipient Designs, die interaktive Herstellung und Bearbeitung von Bewertungen. An diese Studien knüpft Malone (1995; 1997) an und schlägt vor, das Identitätskonzept altercasting (vgl. Weinstein & Deutschberger 1963) als Form des Recipient Designs zu betrachten. Mit altercasting werden Selbst- und Fremdpositionierungen projiziert und dadurch intersubjektiv hergestellt.1 Malone (1997: 106ff.) beobachtet dabei Mechanismen der perspective display series, die es ermöglichen, eigene Positionierungen erst nach gemeinsam etablierten Perspektiven anzubringen. Damit zeigt Malone erstmals die Verbindung zwischen Positionierung und Recipient Design auf.
Grundsätzlich sind all diejenigen Praktiken in den Zusammenhang mit dem Recipient Design zu setzen, die dazu dienen, gemeinsames Verstehen auszuhandeln und sicherzustellen, dass das Gesagte als Teil des Common Grounds gelten kann (vgl. Deppermann & Blühdorn 2013: 10; vgl. auch Deppermann 2008b; Hitzler 2012: 131ff.). Dazu gehören Rückmeldeverhalten, Reparaturen2 und Reformulierungen, die vielfach in der konversationsanalytischen Forschung thematisiert werden, wenn auch häufig keine explizite Verbindung zu dem Konzept des Recipient Designs hergestellt wird. Deppermann und Blühdorn (2013) zeigen beispielsweise in ihrer Studie, dass Negation als verstehenssteuerndes Verfahren und damit als spezifische Design-Aktivität betrachtet werden kann. So können durch Negationen mögliche Interpretationen des Gesagten, die jedoch nicht intendiert sind, bei den Gesprächsteilnehmenden ausgeschlossen werden.
Schmitt und Knöbl (2013; 2014) stellen schliesslich erste Überlegungen zum multimodalen Recipient Design an und zeigen, dass zusätzlich zur Verbalität weitere Ressourcen wie Blickverhalten, Körperausrichtung und Gestik das Recipient Design beeinflussen. Für die multimodale Interaktionsforschung muss daher auch die bisherige Konzeption überdacht und erweitert werden. Schmitt und Knöbl nehmen Präzisierungen des Konzepts vor, die auch für die folgenden Überlegungen wichtig sind, obschon die vorliegenden Daten keine multimodale Analyse zulassen.
Die Ausführungen zu Design-Aktivitäten können nicht als abschliessende Zusammenschau verstanden werden, sondern es soll damit aufgezeigt werden, welche Breite das Konzept des Recipient Designs abdeckt und welche Aspekte als für das Konzept konstitutiv betrachtet werden. In der empirischen Analyse der vorliegenden Studie sollen Praktiken der Adressierung und des Gebrauchs von Referenzen in den Zusammenhang gebracht und auf ihre Funktionen hin untersucht werden. Weiter soll es darum gehen, die für schulische Beurteilungsgespräche typischen Positionierungsaktivitäten zu spezifizieren.
2.2.3 Aufgaben und Herausforderungen in der Mehrparteieninteraktion
Im Vergleich zu dyadischen Gesprächen sehen sich Gesprächsteilnehmende in Mehrparteieninteraktionen mit zusätzlichen Aufgaben und Herausforderungen konfrontiert, die massgeblich mit dem Recipient Design und der Gesprächsorganisation in Verbindung stehen (vgl. z.B. Sacks, Schegloff & Jefferson 1974: 712ff.; Schegloff 1996b: 19ff.). Zum einen müssen sich Gesprächsteilnehmende jeweils gleichzeitig an mehreren Rezipierenden orientieren und ihre Äusserungen so gestalten, dass möglichst alle Beteiligten in Bezug auf ihre Wissensbestände, Rollen etc. optimal berücksichtigt werden (vgl. Hitzler 2012: 117ff.; 2013: 113ff.). Zum anderen kann in Gruppengesprächen im Prinzip jede anwesende Person den nächsten Turn übernehmen und so muss angezeigt werden, wer beispielsweise auf eine Frage antworten soll. Die Zuweisung des Rederechts gewinnt dadurch an zusätzlicher Bedeutung und kann durch spezifisches Turn Design und durch die Verwendung von Adressierungsformen und Referenzen verdeutlicht werden (vgl. z.B. Malone 1997: 42ff.; Schegloff 1996b: 20).
Da in Mehrparteieninteraktionen davon ausgegangen werden muss,