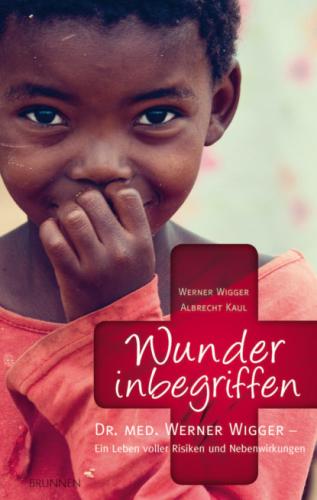Als Werner wieder in Reih und Glied steht und das Buch aufschlägt, entdeckt er im Innendeckel eine handschriftliche Würdigung seiner gesellschaftlichen Tätigkeit. Obwohl die Widmung vom Direktor unterschrieben ist, erkennt Werner an der Handschrift, dass der Text vom stellvertretenden Direktor geschrieben wurde. Irgendwie erfüllt ihn diese Belobigung beim Fahnenappell mit innerer Genugtuung. Sonst bezeichnet man ihn in der Schule häufig als Außenseiter und Verweigerer – aber heute sehen alle, dass er nicht grundsätzlich dagegen ist und für die Schule eine wichtige Aufgabe freiwillig übernommen hat.
Wie ist es dazu gekommen? Werner hat die Aufgabe, für den Geografieunterricht die benötigten Landkarten aus dem Kartenraum vom Boden der Schule zu holen. Immer wieder fällt ihm dabei der desolate Zustand der Karten auf und er fragt, ob er versuchen solle, die Karten zu reparieren. Sein Klassenlehrer Sauermann hat nichts dagegen. So verbringt Werner viele Nachmittage auf dem Boden und entdeckt dort eine wahre Schatzkammer. Die handwerklichen Arbeiten liegen ihm. Er bringt sich Werkzeug von zu Hause mit, klebt und flickt die Karten und repariert gebrochene Leisten.
Während die Karten vor ihm auf dem Boden liegen, versucht er immer wieder neue Städte und Flüsse, Inseln und exotisch klingende Länder zu entdecken. Er sucht die Orte, die er aus den Karl-May-Büchern kennt, entdeckt den Titicacasee, auf dem die Uhuru-Indianer mit ihren schwimmenden Schilfinseln leben. Erst kürzlich hat er davon gelesen. Aber auch lustige Namen, wie den Vulkan Popocatepetl und dass Honolulu tatsächlich die Hauptstadt einer Inselgruppe ist. Mit geschlossenen Augen träumt er sich über die Weltmeere und glaubt, den salzigen Wind und die Hitze der Wüsten zu spüren. Ob er diese Orte jemals mit eigenen Augen sehen wird? Er sucht die Städte und Länder, die in den Nachrichten vorkommen, und gewinnt so ein räumliches Bild von der Welt außerhalb der DDR. Weil ihm diese Arbeit so viel Spaß macht, hat er die Karten anschließend katalogisiert und neu geordnet. Jetzt ist es eine Freude für alle Lehrer und Schüler, mit einem Griff die richtige Karte für den Unterricht bereitzuhaben. Die Belobigung des Direktors war wirklich gerechtfertigt.
Auf dem Boden gibt es noch viel mehr zu entdecken: alte mathematische Lehren, Navigationsgeräte für die Seefahrt und verstaubte Garderobe. In einem Schrank, dem der Holzwurm schon kräftig zu Leibe gerückt ist, entdeckt er alte Bücher, darunter sogar einige Bibeln. Die älteste ist mit einem Ledereinband versehen und hat ein ordentliches Gewicht, aber vor allem die Jahreszahl darin bringt ihn zum Staunen – 1785! Als er Armin von seinem Fund erzählt, hat der sofort eine Verwendung dafür. „Nimm sie einfach mit – das ist doch nur eine Rettung von Kulturschätzen.“ Werner traut sich nicht, den Diebstahl zu begehen, auch wenn die Bibel vielleicht eines Tages weggeworfen wird. Bei seinem nächsten Besuch auf dem Boden vergräbt er sie zuunterst im Schrank – in der Hoffnung auf bessere Zeiten.
Das Buch „Wie der Stahl gehärtet wurde“ bekommt einen besonderen Platz auf Werners Bücherbord, es muss griffbereit sein. Man kann ja nicht wissen, wann ihm diese Belobigung noch einmal helfen kann.
Einen Satz der Hauptfigur Pawel Kortschagin hat Werner unterstrichen. Schon im Unterricht haben sie darüber gesprochen: „Das Wertvollste, was der Mensch besitzt, ist das Leben. Es wird ihm nur ein einziges Mal gegeben, und nutzen soll man es so, dass einen die Schande einer niederträchtigen und kleinlichen Vergangenheit nicht brennt, und dass man sterbend sagen kann: Mein ganzes Leben, meine Kraft habe ich dem Herrlichsten in der Welt, dem Kampf um die Befreiung der Menschheit gewidmet.“
Das ist ihm wichtig, weil die Bibel das ganz ähnlich sieht. Das Leben ist einmalig. Es ist uns von Gott gegeben und hat einen einzigartigen Wert. Der Unterschied besteht darin, dass Christen nicht von einer Selbsterlösung des Menschen träumen. Vielmehr wissen sie, dass Gott ihnen die Befreiung von Schuld und Hoffnung auf eine ewige Erlösung durch Jesus versprochen hat. Dafür will Werner sich einsetzen, dass viele davon erfahren.
Eigentlich ist es ihm zuwider, ständig gegen den Strom zu schwimmen. Die meisten Eltern erziehen ihre Kinder in diesen Tagen so, dass sie sich anpassen. Sie sollen den Weg des geringsten Widerstandes gehen und die Realität der herrschenden Ideologie fraglos akzeptieren. Werners Strategie sieht anders aus: Er will sich nicht anpassen, aber trotzdem durch gute Leistungen Anerkennung finden. Wie steht es in der Bibel? Wir können unsere guten Werke vor den Menschen sehen lassen und sind dadurch auch für Gott ein gutes Aushängeschild. Es geht ihm nicht darum, sich bei den Lehrern einzuschmeicheln, sondern er will zeigen, dass Christen nicht dumm, rückständig oder weltfremd sind, wie sie immer hingestellt werden. Daher ist es für Werner eine Genugtuung, wenn er wegen einer guten Arbeit oder einer genialen Aktion gelobt wird.
Freunde unter schwierigen Bedingungen
Eine vornehme alte Lehrerin aus Ostpreußen unterrichtet Kunstgeschichte. Sie heißt Frau von Minkwitz und wird von den Schülern nur Oma Rosi genannt. In der Lehrerkonferenz hat sie mitbekommen, dass Werner wieder einmal Gesprächsthema war. Was war passiert? Er hatte mit dem kunstbegabten Alfred Heth aus einer älteren Klasse Plakate für eine Laienspielaufführung hergestellt. Das kleine Theaterstück wurde in den Räumen der Gemeinschaft aufgeführt und Werner war nicht nur Organisator, sondern auch einer der Hauptdarsteller.
Da es für die kirchliche Veranstaltung keine Druckerlaubnis gab, hat man sich selbst geholfen und per Linoldruck ein ansprechendes Plakat gestaltet. Werner und Alfred arbeiten beide im Kunstzirkel der Schule, daher druckten sie die Plakate mit Farbe und Walzen nach dem Unterricht in einem der Klassenräume. Schließlich lagen etwa vierzig Blätter zum Trocken auf den Bänken. Am nächsten Morgen fuhr Werner früher in die Schule, um die Plakate einzusammeln. Doch irgendjemand von der Schulverwaltung hatte sie entdeckt und Werner bekam Schwierigkeiten wegen „unerlaubtem Herstellen von Druckerzeugnissen“.
Oma Rosi tut der begabte und einsatzfreudige Werner leid. Sie spricht ihn an und fragt, ob er sie nicht einmal besuchen will. In einer alten, leicht verfallenen Villa wohnt die alte Dame. Zurückhaltend freundlich lässt sie ihn in ihr Wohnzimmer. So eine vornehm eingerichtete Wohnung hat er noch nicht gesehen. Zu Hause ist alles zweckmäßig und spärlich ausgestattet, aber was er hier sieht, verschlägt ihm die Sprache. Es sind zwar keine Reichtümer, denn Oma Rosi musste ja auch gegen Ende des Krieges fliehen, aber die Wohnung hat Stil. Es gibt schöne Polstermöbel und an den Wänden hängen Gemälde aus verschiedenen Epochen. Im Schrank bemerkt Werner jede Menge Kunstbände. Blumen sind geschmackvoll arrangiert und auf dem Tisch steht ein asiatisch aussehendes Teegedeck.
Oma Rosi fordert Werner auf, sich zu bedienen, was er sich kaum traut. Sie sitzt ihm gegenüber und zieht hin und wieder an einer Zigarette, die sie in einer Elfenbeinspitze graziös zwischen den Fingern hält. Sie erzählt von ihrer Heimat, von der Flucht und dass es ihr nicht leichtfällt, in einer sozialistischen Schule zurechtzukommen. Offen gesteht sie Werner, dass sie ihn in seiner Gradlinigkeit bewundert. Dadurch sei er immer wieder einmal Thema in der Lehrerkonferenz. Sie verrät ihm, es gebe drei Gruppen von Lehrern: Zur ersten Gruppe gehörten die, die versuchten, sich aus allen Wertungen herauszuhalten. Die zweite Gruppe bestehe aus den Lehrern, die sich verschworen hätten, „den Wigger“ von der Schule zu kriegen. Und dann gebe es noch eine kleine Gruppe, die vorsichtig versuche, für ihn ein positives Wort einzulegen.
Mit ihrem ostpreußischen Akzent sagt sie unvermittelt: „Werner, Sie sind anders als die Schüler in Ihrer Klasse. Wir müssen Kompromisse machen, um uns im Leben behaupten zu können. Wer sich so vehement gegen die allgemeine Linie stemmt, wie Sie das tun, der kann nur verlieren. Ich bewundere Sie, aber ich habe auch Angst um Sie.“
Es wird ein wunderbares Gespräch. Werner weiß, dass er ihr vertrauen kann. Und so lässt er sie Einblick nehmen in seine Gedanken und das, was ihn bewegt. Oma Rosi hat Verständnis, aber sie ermahnt ihn auch zur Klugheit.
Auf dem Heimweg kommen ihm Zweifel, ob er nicht zu viel erzählt hat. Sie ist ja immerhin Lehrerin, also Vertreterin eines aggressiven atheistischen Staates! Wollte sie ihn nur aushorchen? Aber nein, Oma Rosi ist echt und vertrauenswürdig. Sie