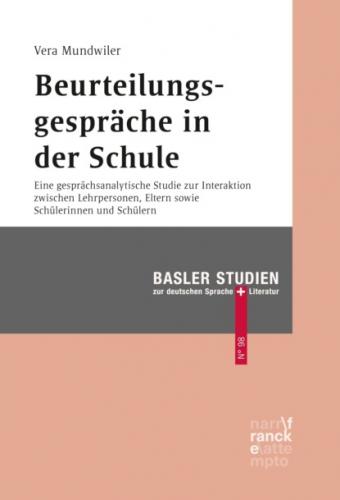Sacks (1995: I: 246, 248) führt in den Vorlesungen von 1966 die Begriffe membership categorization device (MCD) und category-bound activities (übersetzt als kategoriengebundene Aktivitäten) ein. Während er diese als Teilkonzepte innerhalb der Konversationsanalyse betrachtet, wird membership categorization analysis (MCA) später teilweise als eigene Methode verstanden (vgl. Fitzgerald 2012; Stokoe 2012; ten Have 2007: 45ff.). Diese Trennung in zwei Methoden mit unterschiedlichen Interessen wird von Schegloff (2007: 476f.) allerdings kritisiert und auch hier wird die Ansicht vertreten, dass die soziale Kategorisierung mit der sequenzanalytischen Gesprächsanalyse vereinbar ist.
Unter MCD versteht Sacks (1972; 1995) verschiedene Gruppen von Kategorien, wie beispielsweise ‚Alter’, ‚Gender’ oder ‚Beruf’. Kategoriengebundene Aktivitäten sind Handlungen oder auch Beschreibungen von Aktivitäten (vgl. Schegloff 2007: 470), die mit einer solchen Kategorie assoziiert werden und die demnach eine Kategorienzugehörigkeit anzeigen (vgl. auch die Übersicht in Stokoe 2012: 281).2
Insgesamt gewinnen wir durch die Analyse von Mitgliedschaftskategorisierungen Einblick in Rollenzuschreibungen und Erwartungshaltungen von Interagierenden oder wie ten Have (2007: 45) treffend resümiert: „Membership Categorization Analysis (MCA) offers a useful entrée to start analysing the social knowledge which people use, expect, and rely on in doing the accountable work of living together.“ Durch die Aktivierung von Kategorien und Aushandlung von Kategorienzugehörigkeiten wird Alltagswissen der Beteiligten über soziale Gruppen und Identitäten angezeigt (vgl. auch Schegloff 2007: 469). Die Schwierigkeit bei der Analyse liegt darin, nicht das eigene Alltagswissen dominieren zu lassen, sondern jeweils sequenzanalytisch zu prüfen, welche Kategorien und kategoriengebundenen Aktivitäten tatsächlich lokal von den Gesprächsteilnehmenden aktiviert werden (vgl. Deppermann 2013b: 66; Schegloff 2007: 475ff.; Stokoe 2012: 282).3
Mit Deppermann (2013b: 63, 66ff.) gehe ich davon aus, dass die Analyse von Mitgliedschaftskategorisierungen nicht ausreicht, um Identitätskonstruktionen im Gespräch umfassend zu betrachten. Im Folgenden wird das Konzept und Vorgehen der Positionierungsanalyse vorgestellt, die Aspekte der hier diskutierten Kategorisierungen beinhalten, aber darüber hinaus weitere Aspekte der Identitätsanalyse einzubeziehen vermögen.
2.4.3 Selbst- und Fremdpositionierung
Der Begriff positioning wird mit Hollway (1984) in Verbindung gebracht, während die Konzeption(en) der Positionierungstheorie auf Davies und Harré (1990)1 zurück geht und sich ursprünglich in der sozialkonstruktivistischen, diskursiven Psychologie verorten lässt (vgl. Harré & van Langenhove 1999b: 2ff.). Das Konzept der Positionierung wurde insbesondere im Rahmen der gesprächsanalytischen Erzählforschung (vgl. v.a. Bamberg 1997; Bamberg & Georgakopoulou 2008; Lucius-Hoene & Deppermann 2002; 2004) sowie beispielsweise für die Gesprächsrhetorik (vgl. Wolf 1999) weiterentwickelt.
Davies und Harré (1999: 37) definieren Positionierung als „discursive process whereby people are located in conversations as observably and subjectively coherent participants in jointly produced story lines“. Mit Positionierung werden also die sprachlichen Praktiken bezeichnet, mit denen die Beteiligten im Gespräch gegenseitig ihre Identitäten aushandeln, indem sie sich und anderen gewisse Eigenschaften und Rollen zuschreiben (vgl. Lucius-Hoene & Deppermann 2002: 196; 2004: 168; Wolf 1999: 69f.). Positionierung wird dabei als grundlegend dynamischer Prozess verstanden:
With positioning, the focus is on the way in which the discursive practices constitute the speakers and hearers in certain ways and yet at the same time they are a resource through which speakers and hearers can negotiate new positions. (Davies & Harré 1999: 52)
So werden sprachliche Praktiken für die Selbst- und Fremdpositionierung von Beteiligten verwendet, die jedoch nicht als fix zugewiesene Positionen erhalten bleiben, sondern wiederum von den Interagierenden ausgehandelt werden können.2
Die Begriffe Selbstpositionierung und Fremdpositionierung sind dabei nicht als eigenständige Aktivitäten zu verstehen, sondern als jeweils gleichzeitig vollzogene Handlungen:
Indem ich mich selbst beschreibend oder handelnd positioniere, weise ich mir, ebenso aber auch dem Anderen in Relation zu meiner eigenen Position, die ich ihm gegenüber beanspruche, eine Identität zu. (Lucius-Hoene & Deppermann 2002: 196)
Eine Positionierung leistet demnach jeweils eine doppelte Identitätskonstruktion, indem zugleich die eigene sowie die interagierende Person bestimmt werden (vgl. auch van Langenhove & Harré 1999a: 22). Diese Aspekte der Identität können von den Beteiligten weiter ausgehandelt und in den Folgesequenzen entsprechend ratifiziert oder abgelehnt werden. Beteiligte können dabei sowohl Aspekte der Selbstpositionierung als auch der Fremdpositionierung annehmen bzw. zurückweisen (vgl. Lucius-Hoene & Deppermann 2004: 170).
Positionierungen können auf vielfältige Weise sprachlich realisiert werden und dabei unterschiedlich explizit oder implizit sowie direkt oder indirekt ausfallen (vgl. Lucius-Hoene & Deppermann 2004: 171). Wolf (1999: 73) nennt darunter explizite Kategorisierungen, Schilderungen von Situationen und Befindlichkeiten, biografische Selbst- und Fremdthematisierungen sowie Erzählungen von Ereignissen. Sie betont aber, dass die Positionierungen noch impliziter vorgenommen werden können, wie beispielsweise durch auffällige sprachliche Ausdrucksformen oder durch bestimmte Beteiligungsweisen. Es spielt dabei jeweils der lokale Kontext der realisierten Positionierung eine wichtige Rolle (vgl. z.B. Lucius-Hoene & Deppermann 2004: 172).
Lucius-Hoene und Deppermann (2004: 171) beschreiben weiter, welche Aspekte einer Identität durch die Positionierung aktiviert werden können und nennen persönliche Merkmale bzw. psychologische Eigenschaften (z.B. Kreativität), soziale Identitäten (z.B. Lehrperson) und damit verbundene rollenbedingte Rechte (z.B. Kompetenz) sowie moralische Attribute und Ansprüche (z.B. Ehrlichkeit) (vgl. auch van Langenhove & Harré 1999a: 21f.).
Ferner gilt zu beachten, dass die alltagssprachliche Verwendung von Positionierung zwar tendenziell auf aktive, bewusste Entscheidungen verweist, jedoch beim theoretischen Konzept der Positionierung nicht grundsätzlich von einer intendierten Handlung ausgegangen wird (vgl. Davies & Harré 1999: 37; van Langenhove & Harré 1999a: 22). Lucius-Hoene und Deppermann (2004: 171) sprechen auch von einem „ständige[n] Mitlaufen von Positionierungen en passent“ bei sprachlichen Aktivitäten, die nicht primär auf eine explizite Positionierung ausgerichtet sind. Es kann also nicht das Ziel der Analyse sein, nur direkte und explizite Charakterisierungen in den Blick zu nehmen, sondern es soll im Detail untersucht werden, durch welche sprachlichen Aktivitäten gleichzeitig eine Positionierung vorgenommen wird.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die Analyse sich auf Gesprächsdaten verlässt und damit grundsätzlich keine Aussagen zu psychologischen Fragen treffen kann (z.B. ob es sich um bewusste oder unbewusste Positionierungen handelt). Es interessiert bei der Gesprächsanalyse grundsätzlich nur Wissen, das sich aus den Daten heraus erschliessen lässt. So wird nicht untersucht, welche Erwartungen oder welches Rollenwissen Gesprächsteilnehmende beispielsweise an sich bzw. an das Gegenüber als Lehrperson haben, sondern nur welches Wissen davon in der Interaktion relevant gesetzt wird. Wenn auch davon ausgegangen werden kann, dass soziale Rollen durch Erfahrung und vergangene Interaktionen verfestigt werden (vgl. Davies & Harré 1999: 41f.; vgl. auch van Langenhove & Harré 1999b zur Stereotypisierung), so kann dennoch nur der tatsächliche, aktuelle Akt der Positionierung analysiert werden.
2.4.4 Selbst- und Fremdbeurteilung
Im Kontext der Beurteilungsgespräche zeigt sich, dass das Positionieren und das Beurteilen