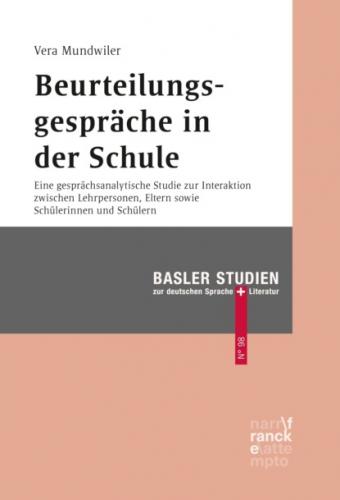2.4 Identität und Positionierung
In der Interaktion geht es unweigerlich um die Ausgestaltung von Identitäten und Beziehungen. Bei der Diskussion des Recipient Designs wurde bereits auf die damit verbundene Positionierungsleistung hingewiesen und wenn auch bei der Besprechung von Beteiligungsrollen nicht der Begriff der Positionierung verwendet wurde, so ist doch die Nähe der beiden Analyseperspektiven deutlich. Hier soll nun das Konzept der Positionierung vertieft werden. Dabei wird zuerst allgemein auf Identität und Identitätskonstruktion eingegangen, dann werden Fragen der Kategorisierung diskutiert und schliesslich werden Aspekte der Selbst- und Fremdpositionierung vorgestellt.
2.4.1 Konstruktion von Identität(en) im Gespräch
Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Identität hat eine lange und interdisziplinäre Forschungstradition (vgl. z.B. Bucholtz & Hall 2005: 586; Spencer-Oatey 2007: 640ff.), wobei hier insbesondere die sprachliche und interaktive Konstruktion von Identität(en) interessiert. Denn erst durch die alltägliche sprachliche Interaktion werden Identitäten ausgehandelt: „It is in these routines of ‚just talking’ that selves are created, maintained, negotiated, and changed“ (Malone 1997: 149).
Schon Goffmans (1955; 1956; 1959) frühe Arbeiten zu facework und zur Selbstdarstellung (presentation of self) untersuchen Identität als interaktives Phänomen. So beschreibt Goffman (1955) line als die Herstellung von Identität in der Interaktion und face als positiv attribuiertes Selbstkonzept:
In each of these contacts, he [every person] tends to act out […] a line – that is, a pattern of verbal and nonverbal acts by which he expresses his view of the situation and through this his evaluation of the participants, especially himself. Regardless of whether a person intends to take a line, he will find that he has done so in effect. The other participants will assume that he has more or less willfully taken a stand, so that if he is to deal with their response to him he must take into consideration the impression they have possibly formed of him. (Goffman 1955: 213)
Goffman versteht line als unvermeidbare Aspekte eines Selbst, die bei jeder Interaktion mitkonstruiert und damit durch die Beteiligten interpretierbar werden. Jede weitere Äusserung steht dann in Relation zu den Selbstdarstellungen, wie sie – intendiert oder nicht – den Beteiligten gegenseitig angezeigt werden. In diesem Zusammenhang führt Goffman (1955: 213) das face-Konzept1 ein und definiert es als „the positive social value a person effectively claims for himself by the line others assume he has taken during a particular contact“. Damit betont Goffman einerseits die (zu schützende) positive Selbstdarstellung und andererseits die lokale und interaktive Herstellung von Identität. Face bezeichnet nicht die selbstbezogene Wahrnehmung der eigenen Person, sondern das erwünschte und zu schützende Selbstbild aus der Perspektive der Anderen und beinhaltet damit eine interaktive, relationale Komponente (vgl. auch Lim 1994: 210). Während Goffman in seinen Arbeiten den Begriff der Identität nicht verwendet, ist dennoch die Beschäftigung mit interaktiv hervorgebrachten Aspekten von Persönlichkeitsmerkmalen deutlich vorhanden und es zeigen sich Bezüge zu Identitätskonzepten. So kommt Spencer-Oatey (2007: 644) zum Schluss, dass die Konzeptionen von face und Identität sehr ähnlich sind, da sich beide auf das individuell, relational und kollektiv konstruierte Selbstbild (self-image) beziehen. Allerdings wird Goffmans face-Begriff aus konversationsanalytischer Tradition kritisiert, da die Konzeption rituelle Einflüsse und Einschränkungen auf das Selbst beinhaltet, während aus Sicht der Konversationsanalyse vielmehr interessiert, wie Menschen in realen Interaktionen anzeigen, wer sie jeweils in Bezug auf die anderen sind (vgl. Maynard 2013: 17; Sidnell 2011: 14f.).2
Die wohl umfassendste Synthese der Identitätsforschung bildet der Ansatz von Bucholtz und Hall (2005), in welchem sie fünf Prinzipien vorschlagen, die für die Identitätsanalyse als konstitutiv angesehen werden können. Diese Prinzipien werden im Folgenden vorgestellt.
Das erste Prinzip nennen Bucholtz und Hall (2005: 587ff.) emergence und weisen damit darauf hin, dass Identität in der Interaktion von den Beteiligten hervorgebracht und manifestiert wird. Diese Sicht der emergenten Identitätskonstruktion stellt sich gegen statische Konzeptionen, die Identität als festen Bestandteil eines Selbst ansehen. In der jüngeren Identitätsforschung gilt diese Ansicht inzwischen als etabliert (vgl. z.B. Antaki & Widdicombe 1998; Marra & Angouri 2011) und wird teilweise durch den Terminus identity-in-interaction noch verdeutlicht (vgl. Aronsson 1998: 75).
Das zweite Prinzip, positionality, zeigt, dass Identität nicht nur die globalen Kategorien wie Alter, Gender etc. beinhaltet, sondern auch lokal entstandene Kategorien und temporäre Rollen in der Interaktion. Damit lässt sich Identität nicht als singuläre Einheit verstehen, sondern vielmehr muss von multiplen Identitäten gesprochen werden, die in vielschichtigen Facetten in der Interaktion hervorgebracht werden (vgl. Bucholtz & Hall 2005: 591ff.).
Beim dritten Prinzip, indexicality, geht es um die Art und Weise, wie Identität sprachlich angezeigt wird. Bucholtz und Hall (2005: 593ff.) verstehen unter indexikalischen Prozessen beispielsweise die explizite Benennung von Kategorienzugehörigkeiten, die impliziten Hinweise bezüglich der eigenen Position oder der des Gegenübers, die bewertende oder epistemische Orientierung an der aktuellen Interaktion und den Beteiligungsrollen oder die Verwendung von sprachlichen Strukturen, die ideologisch mit spezifischen Personen und Gruppen in Verbindung gebracht werden. Das indexikalische Prinzip ermöglicht demnach durch diese Anzeigeleistung den Beteiligten (und auch den Forschenden), die Identitätszuweisungen zu erkennen und im weiteren Verlauf der Interaktion auszuhandeln. Die genannten indexikalischen Prozesse zeigen, dass Identität auf verschiedenen Ebenen hergestellt werden kann und nicht auf eine sprachliche Aktivität begrenzt ist.
Das vierte Prinzip wird relationality genannt und verweist auf die Intersubjektivität von Identitätskonstruktionen. So stehen Identitätszuschreibungen immer in Relation zu komplementären Positionen und situieren die charakterisierte Person in einem sozialen Umfeld (vgl. Bucholtz & Hall 2005: 598ff.).
Das fünfte Prinzip schliesslich nennen Bucholtz und Hall (2005: 605ff.) partialness und heben damit die kontextuelle Situierung von Identitäten hervor, die nur partielle Identitätskonstruktionen ermöglichen und grundlegend dynamisch zu verstehen sind:
Any given construction of identity may be in part deliberate and intentional, in part habitual and hence often less than fully conscious, in part an outcome of interactional negotiation and contestation, in part an outcome of others’ perceptions and representations, and in part an effect of larger ideological processes and material structures that may become relevant to interaction. It is therefore constantly shifting both as interaction unfolds and across discourse contexts. (Bucholtz & Hall 2005: 606)
Hier wird nochmals deutlich, dass mehrere Aspekte der Identität gleichzeitig wirksam sind. Zusätzlich betonen die Autorinnen, dass Identität von den Interagierenden gemeinsam ausgehandelt wird.
Die fünf Prinzipien zeigen Identität in ihrer Komplexität und es wird wohl deutlich geworden sein, dass nicht alle Ebenen in einer Analyse abgedeckt werden können. Auch lassen sich in dem vorgestellten Ansatz Aspekte des face-Konzeptes wiederfinden, wie beispielsweise die interaktive Herstellung von Identität.
Abschliessend stellt sich die Frage, wie sich Identität bei all ihrer Vielschichtigkeit definieren lässt. Bucholtz und Hall (2005: 586) präsentieren mit der Formulierung „Identity is the social positioning of self and other“ eine absichtlich offen gehaltene Definition und zeigen gleichzeitig den teilweise nur impliziten Bezug von Identität und Positionierung: Identität wird durch soziale, interaktive Selbst- und Fremdpositionierung hergestellt. Bevor die Positionierungstheorie genauer vorgestellt wird, soll noch der Aspekt der sozialen Kategorisierung, wie sie in konversationsanalytischen Arbeiten eine lange Tradition hat, diskutiert werden.
2.4.2 Soziale Kategorisierung
Bei der interaktiven Identitätskonstruktion werden u.a.