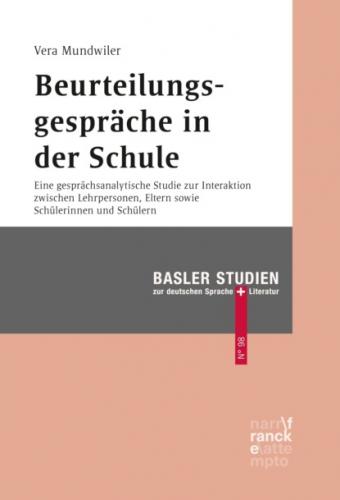Die Rücklaufquote der Fragebögen war leider gering und da teilweise aus Gründen des Datenschutzes die Studienteilnehmenden weder mit Namen bekannt sind, noch je von mir gesehen wurden, war eine erneute Nachfrage meinerseits nicht in jedem Fall möglich. Die Fragebögen werden aufgrund der schmalen Datengrundlage nicht systematisch ausgewertet, sondern dienen bei der Präsentation des Datenmaterials zu einer detaillierteren Beschreibung. So fliessen bei der Besprechung des Korpus ergänzende Hinweise zu den Gesprächen ein (Kap. 3.2.1) und in einem weiteren Teil werden ausgewählte Metakommentare aus den Fragebögen diskutiert (Kap. 3.2.2).
3.1.2 Datenaufbereitung
Bei der Aufbereitung der Daten ist gemäss Deppermann (2008a: 32ff.) so vorgegangen worden, dass zuerst von jedem Gespräch ein Inventar erstellt wurde. Jedes Gesprächsinventar enthält einerseits Informationen zur Aufnahmesituation sowie zum Bearbeitungsstand des Gesprächs und andererseits dokumentiert es den Ablauf des Gesprächs.
Unter den allgemeinen Angaben wird festgehalten, an welcher Schule sowie wann und mit wem das Gespräch geführt wurde und wie lange es gedauert hat. Weiter werden die Sprechersiglen eingeführt, die für die Zuordnung im Gespräch verwendet werden und anonymisiert sein müssen. Für die vorliegenden Daten wurde entschieden, gesprächsübergreifend die institutionellen Rollenbezeichnungen zu verwenden, also L für Lehrperson, M für Mutter, V für Vater (bzw. in einem Fall P für Partner), S für SchülerIn sowie in einem Fall H für Heilpädagogin. Häufig reicht jedoch die blosse Einführung von Sprechersiglen nicht, da die Namen der Gesprächsteilnehmenden sowie teilweise weitere sensible Daten wie Personennamen, Schulnamen, Ortsnamen, Datumsangaben etc. in den Gesprächen explizit genannt werden und aus Datenschutzgründen anonymisiert werden müssen. Bei den Decknamen, den sogenannten Maskierungen, wurde jeweils darauf geachtet, dass die Silbenstruktur sowie beispielswiese die ethnische oder regionale Zugehörigkeit mit den entsprechenden Merkmalen der originalen Benennungen übereinstimmen (vgl. Deppermann 2008a: 31).
Der zweite Teil des Gesprächsinventars dokumentiert den Gesprächsablauf und erfasst hierfür die groben thematischen und strukturellen Entwicklungen im Gespräch. Dadurch dient das Gesprächsinventar dem vereinfachten Auffinden von Phänomenen und Gesprächsphasen. Weiter wird jeweils angegeben, wer wann spricht und in welchen Sequenzen es Auffälligkeiten gibt (z.B. in Bezug auf Geräusche, Veränderungen in der Teilnehmendenkonstellation etc.). In einer letzten Spalte werden Hinweise und Notizen für mögliche Forschungsfragen angebracht. Diese Informationen werden häufig erst nach genaueren Analysen ergänzt oder aber verändert und präzisiert. Die Gesprächsinventare ermöglichen einen raschen Überblick über die Einzelgespräche und dienen der Identifizierung von spezifischen Phänomenen und Sequenzen, die für die Analyse transkribiert werden. Ausserdem lassen sich davon ausgehend die makroskopischen Entwicklungen nachzeichnen (vgl. Deppermann 2008a: 32).
Die nächsten Schritte können unterschiedlich organisiert sein: Entweder erstellt man vollständige Transkripte aller Gespräche und beginnt dann mit der Selektion von Analysesequenzen (so beispielsweise empfohlen bei Hutchby & Wooffitt 2008: 69ff.), oder man wählt ausgehend von den Inventaren die für die Analyse relevanten Passagen und transkribiert entsprechend nur diese Auswahl. Deppermann (2008a: 37) schlägt Letzteres vor, um „zeitintensive Transkriptionen [zu sparen], die nicht ausgewertet werden“. In der vorliegenden Arbeit wurde ein gemischtes Vorgehen gewählt: Etwa von der Hälfte des Korpus wurden mithilfe der FOLKER-Transkriptionssoftware (Schmidt & Schütte 2010; 2011)1 komplette Minimaltranskripte nach GAT 2 (Selting et al. 2009) erstellt. Vor allem zu Beginn schien es wichtig, in die detailreiche Tiefe der Gespräche einzutauchen und beim mehrfachen Anhören, was für eine Transkription unabdingbar ist, die Spezifika der Gespräche besser zu erkennen. Nach den ersten Analysen wurde jedoch aus Zeitgründen auf komplette Transkriptionen verzichtet. Die Transkriptionen wurden bei den restlichen Gesprächen nur für die ausgewählten Phänomene angefertigt. Für diejenigen Auszüge, die für die Detailanalyse ausgewählt wurden, wurden detaillierte GAT 2-Basistranskripte ausgearbeitet.
Da es sich bei den vorliegenden Daten um Gespräche in schweizerdeutschen Dialekten handelt, die nicht als Schriftsprachen existieren, wurden die Transkriptionskonventionen zudem in Anlehnung an die Dieth-Schrift erweitert (Dieth 1986; vgl. auch Burger et al. 1998). Die wichtigsten Änderungen betreffen die Notation von Langvokalen: Während im Standarddeutschen verschiedene Varianten wie ‚ie’, Dehnungs-‚h’ oder auch Doppelvokal für die Anzeige eines Langvokals zur Verfügung stehen, wird im Schweizerdeutschen nur auf die letztgenannte Variante zurückgegriffen. D.h. Langvokale werden systematisch durch Doppelvokal dargestellt. Die zusammengestellten Transkriptionskonventionen finden sich in einer Übersicht im Anhang. Die Transkripte wurden zur besseren Verständlichkeit jeweils interlinear in das Standarddeutsche übersetzt.2
In einigen Gesprächen sprechen einzelne Personen (umgangssprachliches) Standarddeutsch, was dementsprechend gemäss orthografischen Regeln transkribiert wird. Es sind dies die Mutter von Sarah (SJ1_L1A_LMV), der Vater von Zoe (SJ1_L2A_LMV), die Heilpädagogin von Jonas (SJ6_L6A_LHMS) und teilweise der Schüler Ben (SJ4_L3B_LMVS), der sich damit an der Norm, dass Standarddeutsch die Schulsprache ist, orientiert.
In allen Fällen gilt, dass nicht die Transkriptionen als Primärdaten behandelt werden, sondern immer die Aufnahmen selbst. Transkriptionen haben damit nur den Stand eines Hilfsmittels, um die flüchtige Sprache für die genaue Betrachtung zu fixieren. Jedoch gehört das wiederholte Anhören der Aufnahmen zu einem wichtigen Prozess während den Analysen (vgl. z.B. Hutchby & Wooffitt 2008: 69ff.). Zwar wird der Anspruch erhoben, mit einer Transkription möglichst detailgetreu aufzuzeichnen, was in einer Aufnahme zu hören ist, es ist aber beinahe unmöglich, alle Facetten mündlicher Kommunikation in schriftlicher Form festzuhalten. Und es lässt sich auch kaum verhindern, dass nicht auch die eigene Interpretation oder ein spezifischer Analysefokus die Transkription beeinflusst. Beispielsweise werden Pausen oder Lachen unterschiedlich fokussiert und dementsprechend unterschiedlich detailliert transkribiert. Jefferson (1985: 25) kommt daher zum Schluss, dass unsere Aufmerksamkeit auf einzelne Phänomene die Transkription beeinflusst: „It depends a great deal on what we are paying attention to“ (vgl. auch Sidnell 2011: 25). Damit also keine fehlgeleiteten Analysen auf Basis der Transkriptionen entstehen können, ist der ständige Rückgriff auf die Primärdaten notwendig.
3.1.3 Analysevorgehen
Der analytische Zugang basiert auf den vorgestellten Prämissen und Konzeptionen der Gesprächsanalyse (vgl. Kap. 2.1.1) und der Positionierungsanalyse (vgl. Kap. 2.4.3). Als Grundsatz gilt, trotz der Forschungsperspektive von aussen auf das Gespräch, jeweils die Perspektive der Interagierenden einzunehmen und für die Analyse fruchtbar zu machen. Die analytische Aufgabe besteht also darin nachzuvollziehen, wie die Gesprächsteilnehmenden interaktiv Sinn herstellen und einander anzeigen, wie sie das Gesagte verstehen (vgl. Deppermann 2008a: 50; Sacks, Schegloff & Jefferson 1974: 729). Um bei der Analyse diesen Perspektivenwechsel zu vollziehen, wird nach dem Prinzip des next-turn proof procedure vorgegangen (vgl. z.B. Sidnell 2013: 79), d.h. es wird der jeweilig nächste Turn in die Sequenzanalyse einbezogen.
Der erste Analysezugang beginnt aber nicht erst mit der konkreten Sequenzanalyse, sondern schon bei der Erstellung von Gesprächsinventaren als Teil der Datenaufbereitung (vgl. Kap. 3.1.2). Nach der Datenerhebung habe ich jeweils zeitnah für jedes Gespräch ein Inventar erstellt (vgl. Deppermann 2008a: 32ff.). Darin wurden Angaben zu Inhalt und Ablauf sowie erste Beobachtungen und Hinweise für allfällige Forschungsfragen notiert. Diese Inventare dienen einerseits dazu, die Gespräche als Gesamtereignisse zu erfassen und so die Makrostruktur des Gesprächstyps zu identifizieren. Andererseits lassen sich anhand dieser Gesprächsübersicht und den Notizen zu interessanten Phänomenen auch die relevanten Stellen für die mikroskopische Analyse einfacher wiederfinden.
Es wurden dann erste Transkripte erstellt, die ebenfalls den Status einer Erstanalyse einnehmen. Denn durch das mehrfache Anhören der gleichen Stellen entwickelt