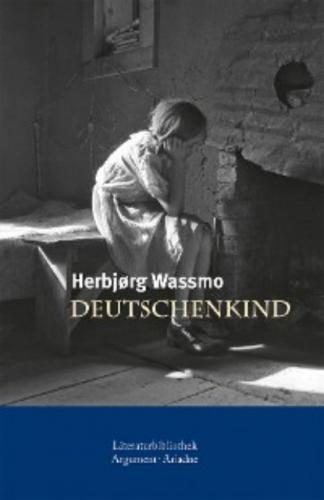Auf dem gegenüberliegenden Ufer der Bucht, wo Heidekraut und niedriges Gehölz beinahe bis an den Wegrand wuchsen, konnte Tora das alte Jugendheim sehen. Es war eigentlich nicht alt, nur sehr verwahrlost. Einst war es rot angestrichen gewesen. Vor dem Krieg. Der Krieg war schon sehr lange her, aber Tora wusste, dass sie ein Teil von ihm war.
Sie hatte viele Geschichten über den Krieg gehört. Aus allem, was sie hörte, wuchs die schreckliche Erkenntnis, dass auch Mama ein Teil von ihm war.
Wenn Henrik vom Krieg sprach, ging Mama ans andere Ende des Zimmers und drehte denen, die gerade anwesend waren, den Rücken zu. Henrik verfluchte den Krieg mehr als jeder andere, denn er hatte ihm beinahe die linke Schulter abgequetscht und sie halbwegs in die Lunge gedrückt.
»Die verdammten deutschen Schweine!«, sagte er und bekam tiefe Furchen zwischen den buschigen Augenbrauen.
Alle waren einer Meinung mit ihm, trotzdem sahen sie weg und warfen Ingrid verstohlene Blicke zu, wenn sie Henriks Ausbruch miterlebten. Mama sprach niemals vom Krieg. Tante Rakel hatte einmal angedeutet, dass Toras Geburt die Großmutter das Leben gekostet habe. Das war nicht für Toras Ohren bestimmt gewesen, deshalb konnte sie auch nicht fragen. Tora fand es seltsam, dass ihre Geburt an Großmutters Tod schuld sein sollte, denn sie konnte sich noch deutlich an sie erinnern, an ein bleiches und mageres Gesicht auf einem weißen Kissen, drinnen in der Kammer bei Tante Rakel und Onkel Simon auf Bekkejordet. Tora wusste, dass alles rationiert gewesen war, so dass die Menschen wenig zu essen und anzuziehen hatten. Vielleicht hatte sie sich verhört, und die Tante hatte gesagt, dass dies die Großmutter das Leben gekostet habe.
Tora stellte sich öfter vor, wie Almar aus Hestvika während der Rationierungszeit auf dem Deck seines klobigen Fischkutters nackt und ausgehungert umhergewandert war. Das musste ein kalter und wunderlicher Anblick gewesen sein. Tora sah immer Almar vor sich und keinen anderen.
Auf der Heide stand also das Jugendheim. Es war auch ein Teil vom Krieg.
Dort hatte man einmal Mamas Haar bis zu der schneeweißen Kopfhaut abgeschnitten.
Tora hatte oft und von vielen davon gehört. Aber sie glaubte vor allem Sols Geschichte: Sie hätten der Mutter das Haar abgeschnitten, weil Tora im Krieg geboren worden war.
Tora dachte indessen, dass sie es sicher deshalb getan hatten, weil sie neidisch auf Mama waren. Denn sie konnte gut sehen, dass auch die neuen Haare ungewöhnlich dunkel und dicht waren. Mama hatte das schönste Haar in ganz Været. Aber dass die Leute so gemein sein konnten? Einmal hatte sie Tante Rakel gefragt.
Da hatte die Tante sie in den Arm genommen und gesagt, dass der Krieg viele Menschen schlecht gemacht habe und dass Tora die Mutter nicht quälen und nicht danach fragen solle.
Aber jedes Mal, wenn Tora an dem Jugendheim vorbeiging, war ihr, als ob sich unsichtbare Hände nach ihr ausstreckten und ihr Böses tun wollten. Das Haus hatte ängstliche kleine Fensteraugen und ein schiefes Muster auf den ausgeblichenen Gardinen, deshalb war es seltsam, dass sie solche Gefühle hatte. Und sie konnte sich nicht vorstellen, dass irgendeiner von den Menschen, die sie auf der Straße, in Ottars Laden oder auf dem Kai sah, die Mutter so gehasst haben könnte, dass er ihr das Haar abgeschnitten hatte. Da musste eher das Haus die Schuld tragen.
Dort war es passiert. Und dort konnte es nun stehen, allein mit seinem immer störenden, zum Moor hin niedergedrückten Drahtzaun und seinen ungestrichenen Wänden, sichtbar für alle Welt! Die Mutter ging niemals mit ihr dorthin. Am 17. Mai und an den Weihnachtsfeiern nahm Tora nicht wie die anderen Kinder teil, bevor sie in die Schule ging.
Tora bildete sich ein, wenn »das Haus« der Mutter nicht die Haare abgeschnitten hätte, dann würden sie bis zu den Hüften hinunterreichen. Sie konnte die Mutter vor sich sehen, im Wind über den Fluss gebeugt, während sie die Wäsche ausspülte. Das Haar schwamm zwischen den Steinen im Fluss direkt hinaus ins Meer. Sie erzählte es Sol.
Aber Sol war zwei Jahre älter und nahm das nicht ernst. »Keine bekommt so lange Haare. Das gibt’s nur im Märchen.«
Sol und der Rest von Elisifs Kindern wohnten genau über Toras Kopf. Morgens rauschte es lange und kräftig in den Rohren da oben. Es waren eben viele, die die Waschschüsseln füllen und sich waschen mussten, gebückt über die Torfkiste beim Ofen und bewacht von Elisifs strengen Augen.
Es scharrte und klopfte und hustete und weinte da oben. Und das musste auch so sein.
Aber es gab natürlich genug Leute, die meinten, es sei doch zu verrückt, dass Elisif die vielen Kinder hatte. Sie waren gezeugt von einem kleinen grauen Mann, der nie mit den Türen schlug oder zur Unzeit ein tadelndes Wort sagte. Ein sanfter Schatten, mit dem niemand an der Seite der starken, dominierenden Elisif rechnete. Indessen standen die Männer rundum an den Wänden in Ottars Laden und grinsten und überlegten, ob bei Elisif auch in diesem Jahr wieder vor Weihnachten etwas Kleines ankommen würde. Das war nicht immer so. Jørgen war jedenfalls am 18. Mai geboren. Tora schien es ein Trost, dass die Leute es für verrückt hielten, dass Elisif jedes Jahr ein Kind bekam. So war sie im Unglück nicht allein.
Als Tora klein war, saß sie bei Ebbe öfter unten am Strand und sah das Licht aus dem Grau und Blau aufsteigen und seinen Schein direkt in den Himmel hineingeben.
»Es ist der Himmel, der dem Meer und der Erde Licht gibt«, sagte Ingrid, als Tora versuchte, ihr verständlich zu machen, was sie sah. Sie saßen oft an der Flussmündung und aßen, während die Wäsche in dem mächtigen Waschkessel zwischen den Steinen kochte. Kaffeemulde nannten die Leute die Stelle. Dort konnte man im Kessel frisches Wasser aus dem Fluss holen und außerdem auf das Meer hinausschauen.
Tora glaubte nicht richtig, was die Mutter vom Licht und vom Himmel sagte. Denn das Meer war doch so unendlich tief. Ganze Schiffe und jede Menge Menschen konnte es verstecken wie nichts. Und doch war es so groß, dass es noch Platz hatte für alles andere, Fische und Tang, Netze und Steine.
Aber sie widersprach der Mutter nicht, sah nur verwundert auf das Glitzern dort unten im Brackwasser, folgte mit den Augen den Strömungen und Wirbeln bis dorthin, wo es das graue Salzwasser erreichte und unter zitternden Schaumkronen grünlich schimmerte. Tora hatte einmal Salzwasser getrunken, weil sie nicht begriffen hatte, dass ein Unterschied zwischen Meer- und Flusswasser besteht. Seitdem vergaß sie den Geschmack nie mehr. Deswegen hatte sie Angst, im Meer zu baden. Sie zog die Kolke im Fluss vor, auch wenn sie kälter waren. Und wenn sie hörte, dass jemand im Meer ertrunken war, hatte sie immer den salzigen, widerlichen Geschmack im Mund. Somit wusste sie ein wenig vom Sterben.
7
Der Herbst war die Zeit der Reisig- und Torffeuer. Die Leute bereiteten sich auf den Winter vor und waren im Haus beschäftigt.
Alle warteten mehr oder weniger auf die große Geschäftigkeit, wenn der Fisch an Land kam.
Da waren Nerven und Glieder angespannt, und man fragte nicht nach Tag oder Nacht, nach Arbeitslust oder Müdigkeit. Einige standen in der Fischfabrik oder in der Gischt. Andere standen am Küchenfenster oder mit dem Ohr dicht am Radio. Kinder weinten, und das Vieh musste gefüttert und der Stall ausgemistet werden, auch wenn die Frauen allein waren. Sie beklagten sich nicht. Es war wichtig, möglichst viel aus der Fischsaison herauszuholen. Da bekamen viele diese Chance zum Geldverdienen. Das war aber auch alles. Ottar und Grøndahl mussten ihr Geld für die Nahrungsmittel bekommen, die vielleicht schon als Mist ausgebreitet auf den kleinen, steifgefrorenen Äckern lagen oder an heimlichen, versteckten Stellen zwischen Tangbüscheln an der Flutgrenze schaukelten. Die Kinder brauchten neue Stiefel und Skihosen und Kleider für drinnen, damit sie sich sehen lassen könnten, wenn es Weihnachten wurde.
Den Torf nahm man nur zum Feueranmachen, dann kam der Kohlenhändler zum Zug. Wer später im Jahr schlachtreife Schafe im Stall hatte, konnte sich freuen, wer aber das Fleisch kaufen musste, konnte bluten. Solchen Leuten blieb nichts anderes übrig, als den Kopf über Wasser zu halten und das Leben weitergehen zu lassen. Schweinefleisch sollte der Teufel essen. Denn nur bessere Leute und solche mit einer tüchtigen Frau im Hause, die ein Schwein zu mästen verstand, konnten sich diesen Luxus leisten. Simon auf Bekkejordet behauptete,