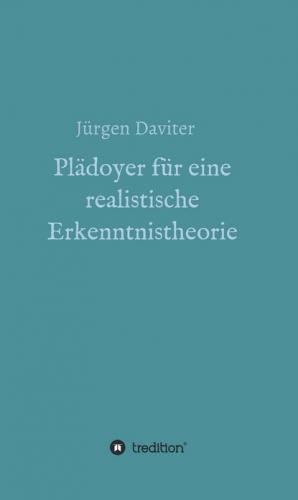Immanuel Kant
1. Vorbemerkung zu den Originalquellen
Hume hat seine Erkenntnistheorie hauptsächlich in zwei Schriften niedergelegt.54 Die erste veröffentlichte er 1739 und 1740 im Alter von unter 30 Jahren‚ und zwar anonym unter dem Titel Treatise of Human Nature (Traktat über die menschliche Natur).55 Darin ist Buch I mit dem Titel „Of the Understanding“ („Über den Verstand“) der Erkenntnistheorie gewidmet. Die zweite Schrift erschien 1748 und erhielt nach mehreren Neuauflagen den Titel An Enquiry concerning Human Understanding (Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand). Hume sah sich aus mehreren Gründen zu dieser neuen Darstellung seiner philosophischen Ansichten veranlasst. Die erste Schrift war zunächst kaum beachtet worden; er glaubte‚ er habe sie zu früh veröffentlicht‚ und wollte einige „Nachlässigkeiten seines früheren Gedankengangs und noch mehr des Ausdrucks“ beseitigen. Die Enquiry war erheblich kürzer als der Treatise und in einem eleganten und eingängigen Stil geschrieben; anders als der Treatise fand sie sehr bald große Resonanz.
Humes Erkenntnistheorie wurde von seinen Zeitgenossen zum Teil scharf kritisiert‚ nach Auffassung Humes und auch aus heutiger Sicht oft unqualifiziert. Was für Hume jedoch am wichtigsten war: Die Kritik richtete sich regelmäßig gegen sein Jugendwerk‚ und die spätere Enquiry wurde dabei kaum beachtet. Deswegen stellte er einer ihrer letzten Auflagen eine Bekanntmachung voran‚ in der er den Wunsch äußerte‚ ausschließlich die Ausführungen dieses Buches als Darstellung seiner philosophischen Ansichten und Grundsätze zu betrachten. Dem entspricht die folgende Beschäftigung mit Humes Erkenntnistheorie; sie bezieht sich fast ausschließlich auf die Enquiry. In ihr sind die letztgültigen Ansichten Humes über das erkenntnistheoretisch wohl wichtigste Problem‚ das der kausalen Erkennbarkeit der Welt‚ für alle philosophisch Interessierten allgemein verständlich formuliert.56
2. Der radikale Bruch mit der „alten“ Metaphysik
Hume kann man als den Philosophen bezeichnen‚ der den von Descartes eingeschlagenen Weg konsequent zu Ende gegangen ist. Descartes hatte sich selbst und dem Menschen überhaupt die Aufgabe gestellt‚ aus eigener Kraft nach wahren Erkenntnissen über die Welt zu suchen. Doch am Ende musste er sich auf die Hilfe eines wohlwollenden Gottes verlassen. Der Wahrheitsanspruch Descartes‘ blieb also letzten Endes metaphysisch‚ er war nicht durch Erfahrung sicher begründet. Hume lehnte Metaphysik als Element oder gar tragenden Pfeiler des Begründungssystems kategorisch ab. Für ihn war der Mensch nicht nur eigenverantwortlich für alle seine Erkenntnisbemühungen‚ sondern er blieb auch - dies nun anders als bei Descartes - endgültig auf seine Wahrnehmungen und deren Verarbeitung durch den eigenen Verstand beschränkt.
Auf diesen Standpunkt legt sich Hume schon im einleitenden Abschnitt I fest („Über die verschiedenen Arten der Philosophie“). Er spricht von der „tiefgründigen und abstrakten Philosophie“ als „Quelle von Ungewissheit und Irrtum“ (EHU‚ S. 23); die „einzige Methode“ und das einzig vertretbare Motiv und Ergebnis der Erkenntnissuche seien „eine ernsthafte Untersuchung der Natur des menschlichen Verstandes und der aus exakter Analyse seiner Kräfte und seiner Fähigkeit gewonnene Nachweis‚ dass er in keiner Weise für solche entlegenen und dunklen Aufgaben geeignet ist“ (EHU‚ S. 25). „Genaues und richtiges Denken ist das einzige universale Heilmittel …‚ jene dunkle Philosophie und das metaphysische Kauderwelsch zu untergraben‚ das … diese für sorglose Denker in gewisser Weise undurchdringlich macht und ihr den Anschein von Wissenschaft und Weisheit gibt.“ (EHU‚ S. 27.) „Und wir müssen die wahre Metaphysik mit einiger Sorgfalt pflegen‚ um die falsche und verdorbene zu zerstören.“ (EHU‚ S. 25.)57 Bei einer solchen Ansicht darf es nicht verwundern‚ wenn Hume im letzten Absatz der Enquiry sarkastisch feststellt: „Wenn wir … unsere Bibliotheken durchgehen‚ welche Verwüstung müssten wir dann anrichten? Nehmen wir irgendein Buch zur Hand‚ z. B. über Theologie oder Schulmetaphysik‚ so lasst uns fragen: … Enthält es eine auf Erfahrung beruhende Erörterung über Tatsachen und Existenz? Nein. So übergebe man es den Flammen‚ denn es kann nichts als Sophisterei und Blendwerk enthalten.“ (EHU‚ S. 421.)
Die alte‚ falsche und verdorbene Metaphysik war für Hume die rationalistische Philosophie‚ die vorgab‚ allein aus Denkakten heraus Wahrheiten über Dinge begründen zu können‚ die außerhalb der erfahrbaren Welt liegen (z. B. Gottes Existenz)‚ und die - oft mit Hilfe solcher „Einsichten“ - auch die Dinge dieser Welt allein aus dem Denken heraus glaubte erklären zu können. Oswald Külpe spricht treffend von der „Metaphysik als Lehre von dem Unerfahrbaren“58. Die „wahre Metaphysik“ dagegen ist in den Augen Humes jene Philosophie‚ die nach gründlichen erkenntnistheoretischen Reflexionen zu der Einsicht führt‚ dass genau das‚ nämlich eine Lehre von etwas Unerfahrbarem‚ nicht möglich ist. Seine „wahre Metaphysik“ ist dieselbe Metaphysik‚ die Kant etwas später im Titel seiner Prolegomena erwähnt: in den Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik‚ die als Wissenschaft wird auftreten können. Descartes war einen überzeugenden Beweis für den Wahrheitsanspruch der „alten“ Metaphysik schuldig geblieben. Die Erkenntnistheorie‚ die Hume in der Enquiry entwirft‚ bricht zum ersten Mal in der Philosophie radikal und wohlbegründet mit der Annahme kausaler Gewissheiten und ist - entsprechend den ersten beiden oben zitierten Mottos - ein einzigartiges und zu seiner Zeit unerhörtes Plädoyer für ein bescheidenes Urteil über die Erkenntnismöglichkeiten des Menschen.
3. Unsere „lebhaften Perzeptionen“ als Grundlage der Ideen
Im Abschnitt II der Enquiry („Über den Ursprung der Ideen“) teilt Hume „Perzeptionen des Geistes“ in zwei Klassen ein‚ einerseits Gedanken oder Ideen‚ andererseits Eindrücke; zu den letzteren zählt er „unsere lebhafteren Perzeptionen‚ wenn wir hören‚ sehen‚ fühlen‚ lieben‚ hassen‚ begehren oder wollen“. Und er stellt sofort eine Beziehung zwischen den beiden Klassen in den Vordergrund: Ideen sind „die weniger lebhaften Perzeptionen …‚ deren wir uns bewusst sind‚ wenn wir auf eine der oben erwähnten Wahrnehmungen oder Gemütsbewegungen reflektieren“ (EHU‚ S. 41). Hume lässt keinen Zweifel daran‚ dass er die Eindrücke für grundlegend und entscheidend hält‚ weil „die schöpferische Kraft des Geistes nur auf das Vermögen hinausläuft‚ das uns durch die Sinne und die Erfahrung gegebene Material zu verbinden‚ umzustellen‚ zu vermehren oder zu vermindern… Alle unsere Ideen oder schwächeren Perzeptionen sind Kopien unserer Eindrücke oder lebhafteren Perzeptionen.“(EHU‚ S. 43.) Als Beispiel mag sein Hinweis auf die wohl geschichtsträchtigste Idee dienen‚ die Idee Gottes: „Die Idee Gottes‚ in der Bedeutung eines allwissenden‚ allweisen und allgütigen Wesens‚ entsteht aus der Reflexion auf die Operationen unseres eigenen Geistes und aus der grenzenlosen Steigerung dieser Eigenschaften der Güte und Weisheit.“(EHU‚ S. 45.) Alle Argumentationen Humes laufen darauf hinaus‚ dass uns eine Idee nur in einer „einzigen Weise … in den Geist‚ den Verstand treten kann‚ nämlich durch wirkliches Empfinden und Wahrnehmen“ (EHU‚ S. 47). In einer abschließenden langen Fußnote geht Hume auf die sogenannten eingeborenen Ideen ein. Wenig überraschend lautet sein Fazit: „Nimmt man aber die Termini Eindrücke und Ideen in dem oben erklärten Sinne‚ und versteht man unter eingeboren dasjenige‚ was ursprünglich oder von keiner vorhergehenden Perzeption kopiert worden ist‚ dann können wir behaupten‚ dass alle unsere Eindrücke eingeboren und unsere Ideen nicht eingeboren sind.“ (EHU‚ S. 51.) Damit stellt er die herrschende metaphysische Sicht der Dinge auf den Kopf.
Grundsätzlich darf man diese Vorstellung Humes59 als Vorwegnahme eines heute weitgehend anerkannten Grundgedankens der Evolutionstheorie und der Evolutionären Erkenntnistheorie betrachten: Unsere Sinnesorgane sind die entwicklungsgeschichtlich (phylogenetisch) ursprünglichen Fenster und Türen zur Welt. Eindrücke entstammen direkt der wirklichen Welt und gehen als solche phylogenetisch der Bewusstseinsbildung‚ also auch allen Gedanken