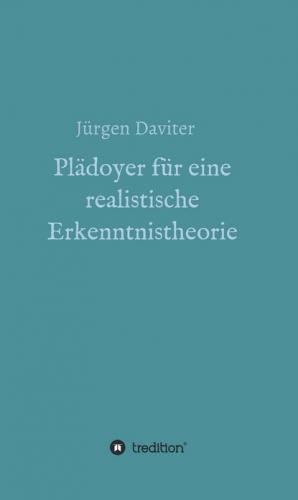Man kann darüber streiten‚ ob das cogito‚ ergo sum eine absolute Sonderstellung einnimmt oder nicht. Es ist zwar das (irdische) Fundament der Erkenntnistheorie Descartes‘. Es ist logisch aber nicht einzusehen‚ dass sein Wahrheitskriterium des Klar-und-deutlich-Sehens‚ das er am cogito‚ ergo sum gewonnen zu haben glaubte‚ für eben diese Ich-Erkenntnis unangefochten bleiben kann‚ während es Descartes für einzelne konkrete Wirklichkeitserkenntnisse durch die Existenz eines nicht-trügerischen Gottes ergänzt. Und tatsächlich hat Descartes selbst schon in der Abhandlung auch das cogito‚ ergo sum nur als wahr gelten lassen‚ weil Gott für ihn existiert. Seine Logik war ja folgende: Er sah das cogito‚ ergo sum klar und deutlich; deswegen war es für ihn wahr; aber alles‚ was wir klar und deutlich sehen‚ hielt er dennoch nur für wahr‚ weil Gott existiert.
Würde man sich dennoch das cogito‚ ergo sum - anders als die Wirklichkeitserkenntnis einzelner realer Sachverhalte - als unangefochten fundamental wahr vorstellen‚ dann endete die Begründungskette einfach schon früher als bei Gott‚ nämlich bei dem für hinreichend erachteten Klar-und-deutlich-Sehen des cogito selbst. Aber auch die Vorstellung‚ dass es „sofort und unwiderstehlich den Verstand für sich einnimmt“‚ oder das natürliche Licht ändern nichts daran‚ dass das Begründungsverfahren an einem Punkt abbricht‚ der dogmatisch gesetzt wird. Unerheblich ist auch die Frage‚ ob das natürliche Licht identisch mit dem klar und deutlich sehen ist. Für die Identität spricht‚ dass Descartes als Verteidigung gegen den Einwand Gassendis das cogito‚ ergo sum deswegen für wahr erklärt‚ weil es sich ihm in dem natürlichen Licht zeigt‚ während er in der früheren Abhandlung für denselben Nachweis das eigene klar und deutlich sehen angeführt hatte. Das klar und deutlich sehen hält Descartes als Wahrheitskriterium schließlich nicht für ganz ausreichend; die Existenz eines nicht trügerischen Gottes muss hinzukommen. Das natürliche Licht hingegen glaubt Descartes in seiner Auseinandersetzung mit Gassendi ohne einen begründenden Obersatz rechtfertigen zu können. Sind klar und deutlich sehen und das natürliche Licht in ihrer vorgestellten Wahrheitsfunktion identisch‚ kann man sie allerdings nicht erkenntnistheoretisch unterschiedlich behandeln. Es müsste dann für beide die Garantie Gottes geben. Doch auch‚ wenn Descartes das natürliche Licht als etwas Höherwertigeres als das eigene klar und deutlich sehen betrachtet haben sollte‚ wäre die Begründungskette nur um ein Glied länger geworden‚ und der Rückgriff auf Gott nicht überflüssig. Ganz gleich‚ wo Descartes die Beweiskette für das cogito‚ ergo sum enden lässt: In jedem Fall handelt es sich um ein dogmatisch gesetztes Wahrheitskriterium.
(4) Abschließende Bemerkungen
Eine abschließende und zusammenfassende Kritik der Erkenntnistheorie Descartes‘ soll mit seinen unabweisbaren Verdiensten beginnen‚ wie sie sich aus den hier diskutierten Texten ergeben. Descartes wendet sich von der bis zu seiner Zeit üblichen Praxis der Wesensbestimmung aus reiner Begriffsanalyse (Essentialismus) ab: Mit solchen „Spitzfindigkeiten“ will er seine Zeit nicht „vergeuden“. Darin liegt ein großes Verdienst; Hegel führte trotzdem fast 200 Jahre später solche Wesensbestimmungen auf einen neuen zweifelhaften Höhepunkt (s. das V. Kapitel). Descartes jedenfalls räumt bei seinem Ringen um Wahrheitserkenntnis der Betrachtung der wirklichen Welt zunächst den Vorrang ein. Ein radikaler Zweifel an der Erkenntnisfähigkeit des Menschen steht dabei am Anfang seiner Suche nach Wahrheit: Der Zweifel als methodisches Prinzip betritt die Bühne der Philosophie. Begriff und Vorstellung von der Seele des Menschen werden durch Begriff und Vorstellung von seinem Bewusstsein ergänzt bzw. ersetzt. Dabei wird der Mensch selbst deutlich als aktives Subjekt der Erkenntnissuche verstanden und zugleich als ihr Problemfall wahrgenommen. Und Descartes entwickelt in Ansätzen eine systematische Methode der experimentellen Forschung. Der grundsätzlichen Frage nach der Erkenntnismöglichkeit überhaupt gesellt sich so die Frage nach dem praktischen Weg der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung hinzu. Damit legt Descartes in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts die Grundlagen der modernen Philosophie als Erkenntnistheorie im Sinne der Suche nach einem sicheren Fundament der Wahrheit von Wirklichkeitsaussagen. Gegenüber eher plausiblen oder intuitiven Erklärungen unseres Wissens oder erkennbar metaphysischen Setzungen erhält nun das Begründungspostulat ein entscheidendes Gewicht.
Das alles macht verständlich‚ warum André Glucksman seiner Monographie über Descartes den Titel „Die cartesianische Revolution“47 gab; von Kirchmann hat in seinem ausführlichen Kommentaranhang zu der hier zitierten Ausgabe der Meditationen diese philosophisch bahnbrechende Leistung Descartes‘ fast ehrfurchtsvoll mit folgenden Worten beschrieben:„Blickt man hier am Schluß dieses berühmten Werkes auf seinen Inhalt zurück‚ so wird deutlich‚ daß sein Titel seine Aufgabe richtig bezeichnet. Es handelt sich darin um die Aufsuchung der Fundamente der Wahrheit und somit um die erste Philosophie‚ d. h. um die Grundlage der Philosophie.“
„Diese Frage nach den Grundlagen der Erkenntnis war vor Desc. noch nie so rein gestellt und für sich behandelt worden. Im Altertum war sie von den Skeptikern und von Aristoteles wohl viel berührt worden‚ aber nirgends mit dem tiefen Ernst wie hier …. Im Mittelalter war man durch die Unterwerfung des Wissens unter den Glauben ganz davon abgekommen. Kein Wunder also‚ daß dieses Werk‚ welches plötzlich die ausgetretenen Wege verließ‚ eine tiefe Erregung innerhalb der Geister hervorbrachte‚ deren Wirkungen durch die späteren Jahrhunderte überall sichtbar sind und diese Frage nach den Fundamenten und den Grenzen der menschlichen Erkenntnis zu der wichtigsten erhoben haben‚ womit seitdem die Philosophie sich beschäftigt hat.“
„Trotz der aufrichtigen Religiosität von Desc. und trotz seiner wiederholten ausdrücklichen Versicherung‚ die Religion über die Vernunft zu stellen‚ hat doch in Wahrheit in diesem Werk der menschliche Geist sich zuerst gründlich von den Fesseln des Glaubens befreit; mit ihm ist der Bruch zwischen Religion und Philosophie vollzogen‚ und alles‚ was seitdem hierin geschehen ist‚ ruht auf dieser Tat des Desc. und verschwindet in seiner Bedeutung gegen ihn.“48
Kann Descartes aber auch seinem eigenen Anspruch gerecht werden‚ einen sicheren Weg zur Wahrheitserkenntnis aufzuzeigen? Fällt Descartes möglicherweise dem Münchhausen-Trilemma zum Opfer? Landet er also im „unendlichen Regress“‚ d. h.: Hat die Begründungskette kein Ende? Oder kommt es zum Abbruch des Begründungsverfahrens? Oder bleibt die Begründung im circulus vitiosus gefangen?49
1. Offenkundig ist die Vorstellung‚ etwas sei sicher wahr‚ weil man es sehr klar und deutlich begreift‚ nicht haltbar: Ohne Rückbezug auf Gott würde hier Evidenz zum Wahrheitskriterium erhoben. Über Jahrtausende haben die Menschen die Erde für eine Scheibe gehalten. Das war für sie evident und ist heute ein abgelegter Glaube.
2. Bei dem Klar-und-deutlich-Sehen des ich denke‚ also bin ich handelt es sich um eine Behauptung‚ die sich auf einen konkreten Teilaspekt der Wirklichkeit bezieht. Musgrave spricht völlig zu Recht von einem „offenkundig ungültigen induktiven Argument“50‚ wenn die (angenommene) Wahrheitsgarantie dieses einen Klar-und-deutlich-Sehens auf alles ausgedehnt wird‚ was man klar und deutlich sieht.
3. Für Descartes ist der einzelne Mensch das erkennende Subjekt; denn es ist der Einzelne‚ der „klar und deutlich sieht“. Es ist aber immer möglich‚ dass der eine etwas auf bestimmte Weise klar und deutlich zu sehen glaubt‚ während es der andere ganz anders‚ aber vermeintlich ebenso klar und deutlich sieht. Schon deswegen kann Descartes nicht absolut sicherstellen‚ dass der Einzelne bei allem‚ was er klar und deutlich sieht‚ auch nach ernsthaftestem Bemühen nie etwas Falsches für wahr hält. Grundsätzlich fehlt ein Wahrheitskriterium‚ das die intersubjektive Gültigkeit von Aussagen garantiert.
4. Descartes schätzt das auch selbst so ein und verfolgt deswegen seine Begründungskette für die Wahrheit schließlich bis hin zur realen Existenz eines nicht trügerischen Gottes. „Für Descartes war … die Gotteserkenntnis nicht … letztes Ziel‚ sondern Mittel zur Lösung des Erkenntnisproblems.“51 Mit der Annahme der Existenz Gottes kann Descartes in seiner Erkenntnistheorie den unendlichen Regress vermeiden. Aber eben