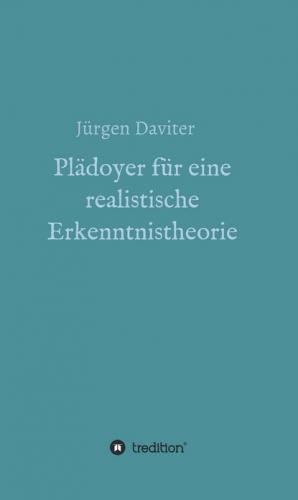Es ist an der Zeit für ein paar kommentierende Bemerkungen.
1. Mit dem Problem‚ aus noch so vielen Erfahrungen gleicher Art nicht ableiten zu können‚ dass es davon auch künftig keine Abweichung geben wird‚ hat Hume - ohne je diesen Begriff zu benutzen - das Problem des Induktionsschlusses aufgeworfen und für unlösbar erklärt. Kant hat etwas später versucht‚ für dieses Problem doch noch eine Lösung zu finden‚ und ist - nach herrschender Ansicht - daran gescheitert. Popper (s. das VIII. Kapitel über den Kritischen Rationalismus) hat zwar von sich gesagt‚ die Lösung des Induktionsproblems gefunden zu haben‚ doch beruht seine ganze Erkenntnistheorie geradezu darauf‚ Humes Skeptizismus grundsätzlich zu akzeptieren; Poppers „Lösung“‚ so zukunftsweisend sie erkenntnistheoretisch auch war - nicht nur‚ was die rationale Begründung einer wissenschaftlichen Methodologie angeht -‚ besteht denn auch nicht in dem Nachweis der Möglichkeit sicherer Erkenntnis von Naturgesetzen. Und es ist heute immer noch keine Lösung bekannt: Der induktive Schluss von der Vergangenheit auf die Zukunft gilt aus guten Gründen als logisch und empirisch unmöglich.
2. Hume hatte auf die Notwendigkeit eines Mittelbegriffs hingewiesen. Mit diesem Begriff verweist er auf die von Aristoteles entwickelte Syllogistik64. Beim Mittelbegriff handelt es sich um einen Urteilssatz‚ der erlaubt‚ zwei andere Urteilssätze so zu verknüpfen‚ dass der eine aus dem anderen logisch geschlossen werden kann. Für Humes Brot-Beispiel würde das konkret Folgendes bedeuten: Der Satz Ich werde ernährt lässt sich nicht logisch aus dem Satz Ich esse Brot schließen. Würde es aber das Naturgesetz Brot ernährt (als „Mittelbegriff“) geben‚ wäre ein solcher Schluss möglich; man könnte dann sagen: Ich esse Brot‚ und weil Brot ernährt‚ werde ich ernährt. Hume hat überzeugend argumentiert‚ dass das Gesetz Brot ernährt jedoch nicht aus noch so vielen Erfahrungen mit dem Essen von Brot sicher geschlossen werden kann: Die Sammlung noch so vieler gleichartiger Erfahrungen ist kein Beweisverfahren und sichert keine Allgemeingültigkeit; denn es ist niemals auszuschließen‚ dass nicht doch eines Tages eine Erfahrung gemacht wird‚ die den bisherigen zuwiderläuft. Darin liegt die Unmöglichkeit des Induktionsschlusses. Wie wir zu einem gut brauchbaren Wissen über angenommene Naturgesetze kommen können‚ erweist sich dennoch oder gerade deswegen - auch nach Hume - als das wichtigste Problem der Erkenntnistheorie und der Wissenschaft.65
3. Hume wurde oben zitiert mit der Ansicht‚ dass die Ideenassoziationen „für uns der Zement des Universums“ seien‚ also gedankliche Konstruktionen uns ein solch zusammenhängendes Bild von der Welt machen lassen‚ dass wir uns in ihr zurechtfinden können. Andererseits ist er nicht müde geworden zu betonen‚ dass es für solche aus Erfahrungen abgeleiteten Vorstellungen über Kausalbeziehungen keine sicheren Wahrheitskriterien gibt. Wir gestalten also unser Leben nach vorgestellten Naturgesetzen ohne sichere erkenntnistheoretische Begründung. Das mag als widersprüchlich oder gedanklich unerlaubt angesehen werden und wurde es auch oft genug. Seine Antwort darauf gibt Hume im nächsten Abschnitt der Enquiry.
5. Skeptische Lösung dieser Zweifel
Noch einmal: Humes Problem ist‚ dass sich Kausalbeziehungen weder durch reines Denken noch durch Erfahrungen beweisen lassen. „In der Metaphysik gibt es keine dunkleren und ungewisseren Ideen als die der Macht‚ Kraft‚ Energie oder der notwendigen Verknüpfung‚ mit denen wir uns doch notwendig in jedem Augenblick unserer Untersuchung befassen müssen.“ (EHU‚ S. 167.) Aber auch die Erfahrungen aus der Betrachtung der wirklichen Welt sind für Hume keine Quelle der sicheren Erkenntnis kausaler Zusammenhänge. Kategorisch stellt er fest: „Kein Gegenstand enthüllt jemals durch die Eigenschaften‚ die den Sinnen erscheinen‚ die Ursachen‚ die ihn hervorgebracht haben‚ oder die Wirkungen‚ die aus ihm entstehen werden; ….“ (EHU‚ S. 85) Die praktische Lösung des Problems liegt für ihn in der menschlichen Natur. Der Mensch hat „trotz seiner ganzen Erfahrung keine Idee oder Kenntnis der geheimen Kraft erlangt‚ durch die der eine Gegenstand den anderen hervorbringt‚ noch wird er durch irgendeinen Denkvorgang zu einer solchen Folgerung verpflichtet. Dennoch sieht er sich veranlasst‚ sie zu ziehen. Und wenn er auch davon überzeugt wäre‚ dass sein Verstand an dieser Operation nicht beteiligt ist‚ würde er dennoch in denselben Bahnen weiterdenken.“ (EHU‚ S. 119.) Hume bringt als Verhaltensweise die Gewohnheit ins Spiel. „… sicherlich nähern wir uns hier einem wenigstens sehr einleuchtenden‚ wenn nicht wahren Satz‚ indem wir behaupten‚ dass wir gemäß einer beständigen Verbindung zweier Gegenstände - z. B. Hitze und Feuer‚ Gewicht und Masse - einzig durch Gewohnheit bestimmt werden‚ das eine beim Auftreten des anderen zu erwarten. Das scheint die einzige Hypothese zur Erklärung der Schwierigkeit zu sein‚ weshalb wir aus tausend Fällen etwas ableiten‚ das wir aus einem einzigen Fall‚ der sich doch in keiner Weise von ihnen unterscheidet‚ nicht ableiten können. Die Vernunft ist eines solchen Wechsels nicht fähig. Die Schlüsse‚ die sie aus der Betrachtung eines Kreises zieht‚ sind dieselben‚ die sie aufgrund einer Prüfung aller Kreise in der Welt ziehen würde. Aber niemand‚ der nur einen Körper gesehen hat‚ wie er sich nach dem Stoß durch einen anderen bewegt‚ könnte schließen‚ dass sich jeder andere Körper nach einem ähnlichen Stoß bewegen würde. Alle Schlüsse aus der Erfahrung sind somit Wirkungen der Gewohnheit‚ nicht des Denkens.“ (EHU‚ S. 121f..)
Hier hat Hume noch einmal auf den Unterschied zwischen der demonstrativen Beweismöglichkeit des Zusammenhangs von Ideen einerseits und der Unmöglichkeit des Beweises von Vorstellungen über Tatsachenzusammenhänge andererseits hingewiesen‚ dabei aber sofort betont‚ dass wir dennoch aus der Erfahrung Schlüsse ziehen. Hume nennt also „die Gewohnheit die große Führerin im menschlichen Leben… Ohne den Einfluss der Gewohnheit würden wir schlechterdings nichts von all solchen Tatsachen wissen‚ die jenseits dessen liegen‚ was Gedächtnis und Sinnen unmittelbar gegenwärtig ist. Wir würden niemals Mittel den Zwecken anzupassen wissen oder es verstehen‚ unsere natürlichen Kräfte zur Erzeugung einer Wirkung zu gebrauchen.“ (EHU‚ S. 125f..)
Es mag als etwas befremdlich erscheinen‚ dass Hume das Problem der Unerkennbarkeit kausaler Zusammenhänge ganz überwiegend an Alltagsproblemen erörtert und folglich auch nur auf die gewohnheitsmäßigen Reaktionen zu deren Bewältigung abhebt. Sein Ziel ist dabei genau das‚ was er in dem Titel des Abschnitts ankündigt: die Lösung des Problems. Als Realist sieht er‚ dass die Menschen bei der Bewältigung der Alltagsprobleme ihres Lebens zu keiner Zeit entscheidend darunter gelitten haben‚ Kausalbeziehungen nicht sicher erkennen zu können. Den Grund dafür sieht Hume darin‚ dass sich die Überzeugungen‚ die aus Erfahrungen stammen‚ von reinen Fiktionen des Geistes und „ungebundenen Träumereien der Phantasie“ (EHU‚ S. 135) unterscheiden. Der Charakter der Kausalvorstellung wird dadurch weiter präzisiert: Es bleibt dabei‚ dass sie kein sicher wahres Ergebnis einer logischen oder empirischen Schlussfolgerung sein kann; aber dennoch ist sie wenigstens plausibel begründet‚ nämlich durch die ins Bewusstsein gedrungene Erfahrung. In diesem Sinne spricht er von einer „Art prästabilierter Harmonie zwischen dem Lauf der Natur und der Abfolge unserer Ideen‚ und wenngleich die Mächte und Kräfte‚ von denen ersterer regiert wird‚ uns völlig unbekannt sind‚ so haben doch unsere Gedanken und Vorstellungen … dieselbe Bahn genommen wie die anderen Werke der Natur“ (EHU‚ S. 151). Damit betont Hume die drei wohl wichtigsten Gesichtspunkte seiner Erkenntnistheorie: seinen Glauben an die gesetzmäßige Ordnung der Natur‚ seine gut begründete Vorstellung‚ dass wir die dieser Ordnung zugrundeliegenden Kausalbeziehungen nicht zweifelsfrei erkennen können‚ und wiederum seinen Glauben an die tiefe Vernunft der Menschen‚ dennoch erkannte Regelhaftigkeiten