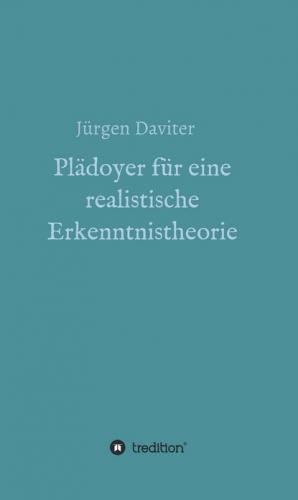6. Schließlich würde aber bei näherer Betrachtung nicht einmal die reale Existenz eines nicht trügerischen Gottes eine Garantie für die Erkenntnis objektiver Wahrheiten auf dem Felde sein‚ für das Descartes seine Erkenntnistheorie entworfen hat: unsere diesseitige reale Welt. Die Zweifel an seinen bis dahin nach eigenem Bekenntnis oft naiv für wahr gehaltenen Wahrnehmungen waren ja der Ausgangspunkt von Descartes‘ Ringen um eine Erkenntnistheorie gewesen. Diese Zweifel zu beseitigen musste auch das letzte Ziel sein. Der Versuch‚ Gottes reale Existenz nachzuweisen‚ war in diesem Zusammenhang - wie Röd zu Recht schreibt - nur ein Mittel zum Zweck. Aus der Überzeugung von der Existenz eines nicht trügerischen Gottes leitet Descartes jedoch ausdrücklich nicht ab‚ dass alle Menschen irrtumsfrei sind und nur wahre Ansichten haben können. Descartes glaubt nur‚ dem Menschen sei von Gott ein Vermögen zur Berichtigung von Unwahrheiten gegeben‚ so dass er die sichere Hoffnung haben könne‚ am Ende die Wahrheit zu erkennen. Für eine Wahrheitsgarantie reicht das aber nicht aus: Auch der nicht trügerische Gott weist einzelne Menschen nicht im konkreten Fall darauf hin‚ wann ihre Erkenntnisbemühungen ausreichen und sie die Dinge so klar und deutlich sehen‚ dass sie der objektiven Wahrheit sicher sein dürften. In diesem Sinne bleibt für Descartes die Wahrheitserkenntnis letztlich eine ureigene Aufgabe des Menschen selber. Ganz klar lässt sich das daran erkennen‚ dass er von ihm den Willen verlangt‚ sich so lange eines Urteils zu enthalten‚ wie die Dinge noch nicht wirklich klar und deutlich sind. Selbst wenn man voraussetzen würde‚ alles klar und deutlich Erkannte sei wahr‚ wäre das Problem nicht dadurch zu lösen‚ dass man es zu einer Frage des rechten Willens erklärt. Dabei bliebe nämlich das Problem ungelöst‚ wie man sicher wissen könnte‚ wann man den rechten Willen hat und wann man andererseits nur glaubt‚ ihn zu haben‚ und sich folglich nur in scheinbarer Sicherheit wiegt. Descartes spricht in diesem Zusammenhang nur davon‚ durch Selbstkontrolle eine gewisse Gewohnheit erlangen zu können‚ nicht zu irren. Das ist kein eindeutiges Kriterium.
Descartes ist eine überzeugende Begründung für seine Behauptung schuldig geblieben‚ die Menschen könnten sicher wahre Erkenntnisse über die Wirklichkeit gewinnen. Sein von ihm als notwendig erachteter Rückgriff auf Gott als Wahrheitsgaranten ist in einem doppelten Sinne ein Ausdruck von Hilflosigkeit: Grundsätzlich muss der Mensch sich auf ein Wesen verlassen‚ über dessen Existenz er nichts sicher wissen kann‚ und selbst unter der Voraussetzung seiner Existenz könnten wir - auch nach den Überlegungen von Descartes selbst - nicht sicher wissen‚ wann Gottes wohlwollende Unterstützung unserer Erkenntnisbemühungen in jeweils konkreten Einzelfällen hinreichend wäre. David Hume hat später den cartesianischen Zweifel denn auch als „völlig unheilbar“53 bezeichnet.
38 René Descartes‚ Abhandlung über die Methode des richtigen Vernunftgebrauchs‚ (Reclam Universal -Bibliothek) Stuttgart 1988 (im Folgenden unter Abh. und Seitenangabe im Fließtext zitiert).
39 Edmund Husserl‚ Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie‚ (Felix Meiner) 2. verbesserte Auflage Hamburg 1982‚ nennt Descartes gar den „urstiftenden Genius der gesamten neuzeitlichen Philosophie“ (S. 80) und sieht bei ihm den „Ausgang der beiden Entwicklungslinien des Rationalismus und Empirismus“ (S. 91).
40 Wolfgang Röd‚ Der Gott der reinen Vernunft. Ontologischer Gottesbeweis und rationalistische Philosophie‚ (Beck’sche Reihe) München 2009‚ S. 12.
41 In diesem Vorgehen ist unschwer Aristoteles wiederzuerkennen‚ nämlich mit seinen von ihm so genannten unvermittelten Prinzipien‚ also solchen‚ die keines Beweises mehr bedürfen (vgl. oben unter I.1.).
42 René Descartes‚ Meditationen über die Grundlagen der Philosophie‚ (Phaidon) Essen o. J.‚ (im Folgenden unter Med. und Seitenangabe im Fließtext zitiert).
43 Wolfgang Röd‚ Der Gott der reinen Vernunft‚ a. a. O.‚ S. 62 f.‚ beschreibt‚ wie der Gottesbeweis als notwendige Voraussetzung für die objektive Gültigkeit von Wirklichkeitsaussagen bei Descartes letztlich darauf beruht‚ auch für das cogito‚ ergo sum noch einen sicheren Grund finden zu müssen; denn daraus hatte er ja das Kriterium des klar und deutlich sehen gewonnen.
44 Zu einer kurzen systematischen Darstellung und Kritik des Gottesbeweises siehe Wolfgang Röd‚ Der Gott der reinen Vernunft‚ a. a. O.‚ S. 158 f..
45 Immanuel Kant‚ Kritik der reinen Vernunft‚ a. a. O.‚ B 611 ff.. Die Art und Weise‚ wie Descartes den Gottesbeweis zu führen versucht‚ wird ausführlich dargestellt und kritisch bewertet von Wolfgang Röd‚ Der Gott der reinen Vernunft‚ a. a. O.‚ insbesondere S. 58-79. - Die im Text zitierte Ausgabe der „Meditationen“ ist eine Wiederauflage einer frühen Ausgabe von Johann Heinrich von Kirchmann‚ der in einem ausführlichen Kommentaranhang ebenfalls immer wieder auf die Unmöglichkeit hinweist‚ aus dem‚ was man gedanklich konstruiert‚ reales Sein ableiten zu können. Zu der Vorstellung der Vollkommenheit‚ zu der Descartes auch die reale Existenz zählt‚ schreibt von Kirchmann z. B.: „Auch hier kehrt die Verwechslung des bloß vorgestellten Seins mit dem wirklichen wieder. Wenn ich ein vollkommenes Wesen vorstelle‚ muß ich mir auch das Sein desselben vorstellen‚ oder das Merkmal: Sein bildet einen wesentlichen Teil dieser Vorstellung; es ist dann im Denken das Sein mit dem Vollkommenen untrennbar verbunden‚ und es ist daher auch richtig‚ dass‚ wenn das eine‚ die Vollkommenheit ‚ wi rkl ich ist‚ auch das andere‚ das Dasein‚ es ist. Allein aus der bloßen Vorstellung von der Untrennbarkeit beider Bestimmungen folgt nicht‚ dass beide auch im Sein bestehen.“ (S. 134.)
46 Immanuel Kant‚ Kritik der reinen Vernunft‚ a. a. O.‚ B 157. Kants These‚ dass aus erfahrungsunabhängigem Denken keine Erkenntnis über die Wirklichkeit gewonnen werden kann‚ ist die Grundidee seiner Kritik der reinen Vernunft‚ s. dazu das IV. Kapitel.
47 André Glucksman‚ Die cartesianische Revolution‚ (Rowohlt) Reinbek bei Hamburg 1989.
48 J. H. von Kirchmann in seinem Kommentar zu den hier zitierten Meditationen‚ a. a. O.‚ S. 144 f.
49 Zum sogenannten Münchhausen-Trilemma s. Hans Albert‚ Traktat über kritische Vernunft‚ (Mohr) Tübingen 1968‚ S. 13 ff.; Karl R. Popper‚ Logik der Forschung‚ (Mohr) Tübingen 1966‚ S. 60 f.‚ bringt eine etwas abweichende Version.
50 Alan Musgrave‚ Alltagswissen‚ Wissenschaft und Skeptizismus‚ (Mohr) Tübingen 1993‚ S. 205.
51 Wolfgang Röd‚ Der Gott der reinen Vernunft‚ a. a. O.‚ S. 13.
52 Ebd.‚ S. 82.
53 David Hume‚ An Enquiry Concerning Human Understanding. Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand. Englisch/Deutsch‚ (Reclams Universalbibliothek) Stuttgart 2016‚ S. 385.
III. Humes Erkenntnistheorie:
Die Entzauberung kausaler Gewissheiten
Die Grenzen des menschlichen Verstandes sind so eng‚ dass man weder hinsichtlich der Ausdehnung noch der Sicherheit seiner Errungenschaften viel Befriedigendes erhoffen kann.
David Hume
So ist die Enthüllung menschlicher