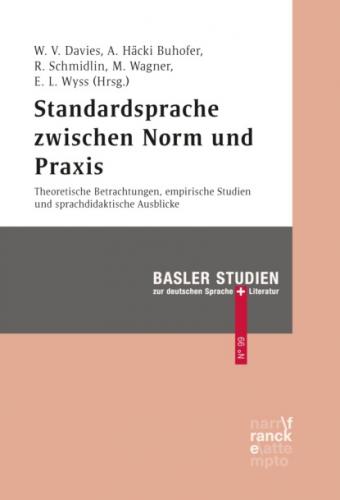Was kann diesen Kritikpunkten entgegengehalten werden? Was die strukturlinguistisch und quantitativ orientierten Einwände anbelangt, ist auf den Unterschied zwischen Types und Tokens hinzuweisen. Gemessen an den Types, also am lexikalischen Inventar, betrifft die Variation der Standardsprache, wie bereits erwähnt, tatsächlich nur einen kleinen Teil des Wortschatzes. Je nach Textsorte kommen diese Wörter aber als Tokens recht oft vor und führen zu Differenzen in der Wahrnehmung von Texten (Schmidlin 2011: 177). Was die normative Geltung anbelangt, so trifft es zwar zu, dass die Einschätzung der Standardsprachlichkeit von Varianten divergieren kann, sogar unter Lexikographinnen und Lexikographen. Jedoch kommen Varianten auch in Qualitätszeitungen vor, welche in der modernen Lexikographie als Beleglieferanten eingesetzt werden, und ein deskriptiver lexikographische Ansatz fordert die Berücksichtigung dieser Varianten ein. Ferner kann das Argument, die Normautoritäten seien sich in Bezug auf die Beurteilung der Standardsprachlichkeit von Varianten des Standarddeutschen selbst nicht einig, dadurch entkräftet werden, dass dies bei anderen Variationsdimensionen, etwa der Stilebene, nicht anders ist. Zum areallinguistischen Einwand, wonach die nationalen Varietäten regional bereits sehr uneinheitlich seien, sei gesagt: Im plurizentrischen Konzept haben beide Variationstypen Platz. Die regionale und die nationale Variation schliessen einander nicht aus. So weist auch Reiffenstein (2001) auf die Durchkreuzung und Unterlagerung der nationalen Varietätsgrenzen durch regionale Variation hin. Niemand wird bestreiten, dass unspezifische Varianten – solche, die sich über die Regionen von mehr als einem Zentrum erstrecken (z.B. Bayern und Österreich) – ungleich häufiger sind als spezifische (z.B. nur in Österreich geltend). Dennoch gibt es sprachliche Bereiche, bei denen Staatsgrenzen kognitiv als Isoglossen wirken können. Mit den Staatsgrenzen gehen Sachspezifika und ein institutionell bedingter Wortschatz einher, wie etwa die Sprache der Gesetzgebung. Diese lexikalischen Spezifika wirken besonders auf die sprachliche Identitätsbildung und Identitätserkennung ein. Dem areallinguistischen Einwand kann also entgegengehalten werden, dass es die nationalen Varianten durchaus gibt, wenn auch viele davon Ausdrücke sind, die an nationale Sachspezifika gebunden sind, namentlich die politischen Systeme, das Schulwesen und das weite Feld der übrigen amtssprachlichen Bereiche. Was schliesslich die gefürchtete Bedrohung der sprachkulturellen Kohäsion betrifft: Die deutsche Sprache blickt auf eine lange plurizentrische Tradition zurück. Insgesamt war ihre Entwicklung seit der frühen Neuzeit eher eine Entwicklung der Konvergenz als der Divergenz. Beispiele für letztere (vgl. etwa DDR-Varianten) sind selten. Was für die Plurizentrik (unter Mitberücksichtigung der pluriarealen Variation) vor allem spricht, ist die sprachliche Realität selbst. Als Tokens lassen sich Varianten der Standardsprache besonders in alltäglichen und institutionellen Domänen in hoher Frequenz belegen, auch über Texte mit Lokalkolorit hinaus. Sie werden produziert und als solche von den Sprechern wahrgenommen. Das bedeutet nicht, dass die Varietäten des Deutschen als starre und klar definierte Konstrukte gesehen werden sollen; als System im System sind sie innerer und äusserer Dynamik unterworfen. Dass sich Sprecherinnen und Sprecher verschiedener Standardvarietäten in der Interaktion einander anpassen können und exonormative Varianten übernehmen können, muss ebensowenig als Widerspruch gegenüber dem Modell der Plurizentrik gelten; die Möglichkeit der sprachlichen Akkommodation der Sprecherinnen und Sprecher spricht nicht per se gegen Varietäten, mit denen sich die Sprecherinnen und Sprecher identifizieren.
Kommt dazu, dass man sich in einigen Fällen – das betrifft besonders die Lexik – für eine Variante aus einer Variantenreihe entscheiden muss, weil es keine überdachende gemeindeutsche Variante gibt. Dies zeigen z.B. die Variantenreihe Fleischer, Metzger, Fleischhauer, Schlachter etc. und Institutionalismen wie Matura, Matur und Abitur. Dies wird oft vergessen, wenn das monozentrische Modell (wonach die Standardsprache ein geographisch lokalisierbares Zentrum hat und eine Peripherie, die sich mit den Dialekten mischt) dem plurizentrischen Modell als das auch in der Didaktik einfacher handhabbare Modell gegenübergestellt wird mit dem Empfehlung, auf das Gemeindeutsche oder „Binnendeutsche“ (zur Problematik dieses Begriffs Schmidlin 2011: 87) zu fokussieren.
4. Zur Einschätzung standardsprachlicher Variation
Wie ich an anderer Stelle ausführlich dargelegt habe (Schmidlin 2011, Schmidlin 2013), gilt aus Sicht der Sozio- und Variationslinguistik das monozentrische Modell zwar als überholt, es ist jedoch dasjenige Modell, auf das im Zweifelsfall zurückgegriffen wird. Aus der Psychologie wissen wir, dass Einstellungen eine affektive, eine kognitive und eine konative Komponente haben. Mit konativ ist gemeint, dass Einstellungen handlungsleitend sind. Wenn wir davon ausgehen, dass das Zweifeln an der Korrektheit und Angemessenheit sprachlicher Varianten eine Form sprachlichen Handelns darstellt und dass dieses Handeln von Einstellungen geleitet wird, lohnt es sich zu fragen, welche Faktoren diese Handlung beeinflussen.
In Schmidlin 2011 werden mittels eines Internetfragebogens bei über 900 Sprecherinnen und Sprechern aus dem ganzen deutschen Sprachraum Gebrauch und Einschätzung nationaler und regionaler Varianten des Standarddeutschen erhoben. Dabei wurde nicht nur die nationale, sondern auch die regionale Herkunft der Gewährspersonen als Einflussfaktoren erfasst, womit dem im vorliegenden Aufsatz vertretenen Postulat der Perspektivierung des Zweifelns entsprochen wird. U.a. wurden die Gewährspersonen gefragt, mit welchem Wort sie den Satz Er stolperte und bemerkte, dass seine … offen waren am ehesten ergänzen würden, wenn sie diesen in einem Brief oder einem Schulaufsatz schreiben müssten. Sie hatten Schuhbändel, Schuhbänder, Schnürsenkel und andere Varianten zur Auswahl. Als markanteste Variantenloyalitätsgrenze zeigte sich hier die Landesgrenze. Die Gewährspersonen aus Deutschland wählten am ehesten diejenige Variante, die gemäss areallinguistischen und lexikographischen Befunden „ihre“ eigene Variante ist – d.h. die Südwestdeutschen wählten Schuhbändel, die Nord- und Mitteldeutschen Schnürsenkel. Mittlere Loyalitätswerte wiesen Gewährpersonen aus Österreich auf: Sie wählten Schuhbänder neben Schnürsenkel. Die Deutschschweizer aber hielten in dieser Versuchsanlage jeweils Schnürsenkel für angemessener – sie wählten die „eigene“ Variante also eher ab. Auch bei der Beurteilung einer Serie von Varianten im Hinblick darauf, ob sie dialektal, eher dialektal, eher standardsprachlich oder standardsprachlich sind – z.B. einlangen, speditiv, Klassenfahrt, besammeln –, zeigt sich die Landesgrenze als kognitive Grenze, halten doch alle Gewährspersonen aus Deutschland die südlichen Varianten eher für dialektal (was aber die Südwestdeutschen interessanterweise nicht davon abhält, „ihre“ Variante im Lückentext zu wählen), während ihnen die Gewährspersonen aus der Schweiz und vor allem aus Österreich eher standardsprachlichen Status zuschreiben. Aber insgesamt zeigt sich, dass am standardsprachlichen Status der empirisch belegbaren und als standardsprachlich kodifizierten Varianten des Standarddeutschen in einer elizitierten Beurteilungssituation generell gezweifelt wird. Inwiefern sie sie für konditionierte