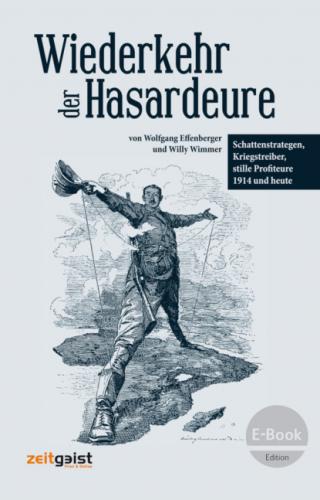Mit Ludwig XVIII. kam nun der Bruder des geköpften Ludwig XVI. auf den Thron, der mit gleichem Pomp, gleichem Unverstand und gleicher Unbeliebtheit herrschte. Auch der seit 1814 tagende Wiener Kongress versuchte, die Revolution ungeschehen zu machen und stellte die Uhren auf die vorrevolutionäre Zeit zurück. Unter dem Losungswort »Solidarität« – es war schon das einigende Band im Kampf gegen Napoleon – wollten die fünf Großmächte England, Russland, Österreich, Preußen und Frankreich Gleichgewicht, Frieden und Ordnung in Europa garantieren. Doch noch während an dieser friedlichen Ordnung gezimmert wurde, schlossen im Januar 1815 England, Frankreich und Österreich einen gegen Russland und Preußen gerichteten geheimen Bündnisvertrag. Hier deutete sich bereits ein geopolitischer Konflikt an: der Gegensatz zwischen der Seemacht England und der Kontinentalmacht Russland. Die Spannungen entwickelten sich in Asien und konnten als erste Anzeichen dafür gedeutet werden, »daß in nächster Zeit die europäischen Gegensätze von Weltgegensätzen überschattet werden«29.
Im Frühjahr 1815 wurde der Wiener Kongress durch die Meldung erschreckt, dass Napoleon an der französischen Küste gelandet sei und auf Paris zustürme. In der Schlacht von Waterloo wurde seiner »Herrschaft der hundert Tage« dann ein Ende bereitet. Als »Feind und Zerstörer der Ruhe der Welt«30 wurde der Weltenbrandentfacher nun auf die abgelegene Atlantikinsel St. Helena verbannt.
Obwohl Frankreich Europa fast ein Vierteljahrhundert in Aufruhr gehalten, mit seinen Truppen überschwemmt und Soldaten aus den eroberten Gebieten gepresst hatte, wurde es maßvoll behandelt und zur Bewahrung des europäischen Gleichgewichts in seinen Grenzen von 1790 belassen.
Auf Anregung von Zar Alexander I. wurde noch vor dem endgültigen Friedenschluss am 26. September 1815 zwischen den Monarchen Russlands, Österreichs und Preußens eine »Heilige Allianz« geschlossen mit dem Ziel, ihre Staaten nach den Grundsätzen des Christentums, der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens zu leiten. Bis auf Großbritannien und den Heiligen Stuhl traten alle christlichen Mächte des Kontinents dieser Allianz bei. Sicherlich galt es, die Fürstenherrschaft zu sichern und ein Bollwerk gegen revolutionäre Erhebungen zu errichten. Doch vor allem verpflichteten sich die Staaten zur friedlichen Konfliktbeilegung. Für England, das sich seiner Unangreifbarkeit bewusst war, standen auf dem Kontinent die eigenen Interessen sowie das Mächtegleichgewicht im Vordergrund, und es konnte seine Rolle bei dieser vertraglich abgesicherten Zusammenarbeit der europäischen Großmächte dort nicht so spielen, wie man es in London beabsichtigte. So entsandte man keine Repräsentanten zu den »Kongressen« der Allianz. In gewisser Weise kann man in dieser »Heiligen Allianz« einen frühen Vorreiter der KSZE/OSZE sehen.31
Als sie englischen Interessen entgegenstand, wurde der Allianz der Todesstoß versetzt. Auslösendes Moment waren in den 1820er-Jahren die Befreiungskriege Serbiens und Griechenlands gegen die türkische Fremdherrschaft. Zur Unterdrückung des Aufstandes verübten im April 1822 die Osmanen an der griechischen Bevölkerung der Insel Chios ein Massaker, das die internationale Öffentlichkeit aufrüttelte und zur Entwicklung des Philhellenismus32 beitrug. Insgesamt sollen 25 000 Inselbewohner ermordet worden sein: alle Kinder unter zwei Jahren, alle Männer über zwölf Jahre und alle Frauen über vierzig Jahre. Der Rest, annähernd 45 000 an der Zahl, wurde auf Sklavenmärkten verkauft. Diese Vorgänge ließen die britische Bevölkerung nicht unberührt. Deren bürgerliches Engagement stand den geopolitischen Zielen Großbritanniens auf dem Balkan entgegen, denn dem britischen Imperialismus war am Erhalt des Osmanischen Reiches vor allem als Gegenkraft zur »Heiligen Allianz« gelegen; es wurde somit als notwendiges Übel geduldet und notfalls unterstützt. Aufgrund des Drucks aus der Bevölkerung half Großbritannien nun trotz entgegenstehender außenpolitischer Ambitionen den Griechen in ihrem Freiheitskampf.
Nachdem der Sultan schließlich vor dem Zaren kapitulieren musste, sah das Londoner Protokoll von 1830 die Errichtung eines kleinen, unabhängigen griechischen Königreiches vor. Es sollte nach dem Willen von Frankreich, Russland und England vom bayerischen Prinzen Otto regiert werden.
Trotz aller Sympathie für die Griechen war die damalige Weltmacht Großbritannien nicht gewillt, die Türken nachhaltig zu schwächen. Das Osmanische Reich sollte weiterhin so stark bleiben, dass es den Russen den Zugang zum Mittelmeer versperren konnte. Und so fürchtete der Zar ein gegen ihn gerichtetes englisch-griechisches Bündnis. Die Franzosen trachteten danach, ihre strategischen wie finanziellen Interessen zu sichern und hätten am liebsten den Status quo aufrechterhalten. Die Freiheit Griechenlands und die Autonomie Serbiens schwächten das Osmanische Reich, ließen bisher unterdrückte Konflikte auf dem Balkan unter Slawen und Muslimen aufbrechen und lösten einen Machtkampf zwischen Wien und Sankt Petersburg aus. Diese Konflikte konnten bis 1914 nicht überbrückt werden.
Neben den um Unabhängigkeit ringenden Serben und Griechen erhoben sich im Juli 1830 in Paris Arbeiter, Studenten und Bürger gegen die Auflösung der Kammer, in der die Liberalen die Mehrheit hatten, sowie gegen Verschärfungen in der Pressezensur. König Karl X. musste nach England fliehen. Den Thron bestieg »Bürgerkönig« Louis Philippe. In Belgien, Polen und Italien wirkte indessen die »Juli-Revolution« nach.
Im Deutschen Bund – einem Flickwerk von kleinen Herzog-, Fürsten- und Königtümern, die in verwickelter Art verbündet oder verfeindet waren – blieben seit dem Wiener Kongress große Teile des Volkes von der Politik völlig unberührt. Dagegen erreichten Kunst und Kultur ungeahnte Höhen: in der Musik etwa durch Mozart, Beethoven und Schubert, in der Literatur durch Schiller und Goethe und in der Philosophie durch Hegel, Schelling und Schopenhauer. Diese beschaulich-geruhsame Zeit wurde später mit dem Etikett »Biedermeier« versehen.
1834 schlossen sich unter der Führung Preußens 18 der 39 deutschen Staaten zum »Deutschen Zollverein« zusammen. Die 1839 fertiggestellte Bahnlinie Leipzig-Dresden markiert den Beginn des deutschen Eisenbahnwesens.
In Frankreich führten Missernten und die Begünstigung der Besitzenden durch Louis Philippe 1848 zur »Februarrevolution«, in deren Folge er abdanken und fliehen musste. Unter dem romantischen Dichter Alphonse Lamartine bildete sich die »Provisorische Regierung« der Zweiten Republik. Das revolutionäre Feuer brannte jedoch weiter. Im Mai folgten in Paris Massenaufmärsche radikaler Sozialisten unter Auguste Blanqui. Sie forderten die Enteignung der Reichen sowie die Vergesellschaftung des Eigentums. Die Regierung ließ die Aufständischen durch das Militär zusammenschießen: 10 000 Todesopfer waren zu beklagen.
Ein Nachkomme des großen Napoleon, sein Neffe Louis Napoléon (1808–1873), wollte an die Zeit seines Onkels anknüpfen und hatte schon 1836 und 1840 erfolglos geputscht. Nun war seine Stunde gekommen, in der er mit Versprechen nicht geizte: So verhieß er den Arbeitern Gemeineigentum, den Bürgern Sicherheit vor dem Umsturz und den Bauern die Erneuerung der napoleonischen Welt und gewann damit bei den Novemberwahlen 1848 Dreiviertel der Stimmen. Als Präsident der Republik forcierte Louis Napoléon den Eisenbahn-, Straßen- und Wohnungsbau und ließ breite Prachtboulevards mit repräsentativen Bauten für Banken und Handel entstehen. Ein Jahr vor dem Ende seiner vierjährigen Amtszeit unternahm er einen Staatsstreich mit dem Ziel, seine Regierungsperiode ohne Wahl zu verlängern. Es funktionierte: Im Januar 1852 wurde die Amtszeit auf zehn Jahre festgesetzt. Noch im Dezember des gleichen Jahres ließ er sich als Napoleon III. zum Kaiser krönen. In einem Plebiszit wurde dieser Schritt von 97 % der Wahlberechtigten bestätigt.
Diesem Ergebnis verpflichtet, wollte er Frankreich Weltgeltung verschaffen und führte es in europäische und überseeische Abenteuer. 1853 nahm er die russische Besetzung der Fürstentümer Walachei und Moldau zum Anlass, Großbritannien zum gemeinsamen Vorgehen gegen den Zaren zu bewegen. Der kluge und geschmeidige Ministerpräsident von Sardinien-Piemont, Camillo Cavour (1810–1861), schloss sich an in der Hoffnung, von Frankreich Unterstützung im italienischen Einigungskrieg zu erhalten. Österreich blieb neutral.
Im September 1854 kam es bei Sewastopol auf der Krim zum ersten Stellungskrieg der modernen Geschichte, der 100 000 Soldaten das Leben kostete.33 Nach einem Jahr Belagerung fiel Sewastopol.