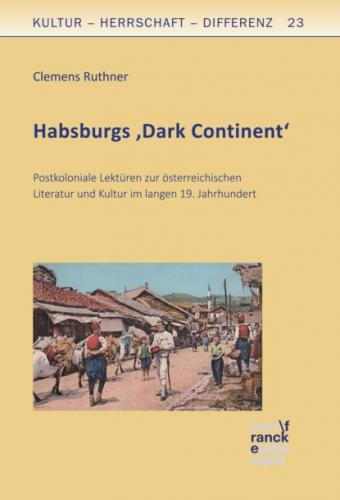Um dieses Verdrängte in den kulturellen Ordnungen „Kakaniens“ im langen 19. Jahrhundert wieder sichtbar zu machen, wird sich die vorliegende Monografie stichprobenhaft jenen kolonialen Vorstellungen und Praktiken in der hegemonialen österreichischen Kultur des Kaiserreichs widmen. Zunächst jedoch ist eine Bestandsaufnahme bestehender Zugänge zu unternehmen, anhand deren sich in einem weiteren Schritt unsere Forschungsfragen und methodologischen Herangehensweisen verdichten werden.
2. Kafka und kein Ende: eine Modellinterpretation (in) der Strafkolonie
„Es ist ein eigentümlicher Apparat“, sagte der Offizier zu dem Forschungsreisenden und überblickte mit einem gewissermaßen bewundernden Blick den ihm doch wohlbekannten Apparat. Der Reisende schien nur aus Höflichkeit der Einladung des Kommandanten gefolgt zu sein, der ihn aufgefordert hatte, der Exekution eines Soldaten beizuwohnen, der wegen Ungehorsam und Beleidigung des Vorgesetzten verurteilt worden war. Das Interesse für diese Exekution war wohl auch in der Strafkolonie nicht sehr groß. Wenigstens war hier in dem tiefen, sandigen, von kahlen Abhängen ringsum abgeschlossenen kleinen Tal außer dem Offizier und dem Reisenden nur der Verurteilte […].1
In der physischen Eindringlichkeit, die sie entwickelt, gehört Kafkas Erzählung In der Strafkolonie (1914) wohl zu seinen drastischsten Texten – geht sie doch buchstäblich „unter die Haut“2 (vgl. IDS 38ff.). Sie scheint prädestiniert für postmoderne und dekonstruktive Lektüren, indem sie den Körper und die Schrift thematisiert,3 respektive die grausige – und doch ästhetische4 – Inskription der einen in den anderen durch eine Tätowierungs-„Schreibmaschine“,5 die die Aufsässigkeit eines Soldaten unverhältnismäßig grausam mit einem langsamen Tod bestraft. Mit seiner ‚subkutan‘-ornamentalen6 Niederschrift durch den „Apparat“ wird das reichlich willkürliche Gerichtsurteil – „Ehre deinen Vorgesetzten!“ (IDS 35) – direkt in die archaisch anmutende und doch technologisch perfektionierte Schindung des Deliquenten umgesetzt, die nach stundenlanger Folter in dessen Exitus gipfelt (vgl. IDS 41). Alexander Honold und andere haben auf „die allen Prinzipien der Gewaltentrennung spottende Kongruenz von Delikt, Gesetz, Urteil und tödlicher Strafe“ hingewiesen;7 Jean-Francois Lyotard spricht in Anlehnung an Artaud von einem „Theater der Grausamkeit“.8
Angesichts der vielfältigen „Einladungen zur Allegorese“ blieb indes im „inventory of traces“9 der früheren Kafka-Forschung das „koloniale Setting“ der Geschichte meist unbeachtet10 – und gerade dieser Bezugsrahmen ist es, der das Werk später in Anschluss an eine Arbeit von Walter Müller-Seidel (1986) zu einem Paradetext postkolonialer Lektüren11 für die Germanistik gemacht hat: Dessen „Traumlogik“ werde, so Paul Peters, zum „skandalösen ‚Rebus‘ des kollektiven, politischen Unbewußten“.12
Kafka fördert mit der Abfassung seines Textes im Oktober 1914, kurz nach Beginn des Ersten Weltkriegs,13 den „versunkene[n] und kollektive[n] Traum des Kolonialismus zutage, die ‚Leiche im Keller‘ der europäischen Metropolen“.14 Dies geschieht in einem Zeitalter, in dem die großen Kriegsverbrechen des westlichen Übersee-Imperialismus – wie die Niederschlagung der indischen Mutiny (1857), die belgischen Gräueltaten im Kongo (1888–1908) und der deutsche Vernichtungsfeldzug gegen die Herero und Nama in Südwestafrika (1904) – bereits geschehen sind und der Übergang zu einer neuen, weniger gewaltsamen Kolonialpolitik merkbar ist, die auf Identitätspolitik und nicht auf Formen der Sklaverei beruht.15
Einer realistischen Lektüre, die die Strafkolonie „kontrapunktisch“16 gleichsam oberhalb ihrer Allegorie-Angebote liest, erschlössen sich im Text also nicht nur ein „Rechtsritual“,17 das Bürokratie,18 Gericht und körperliche Bestrafung in einem allgemeinen – und nachgerade Foucault’schen19 – Sinn vereint, sondern auch die Exzesse kolonialer Gewaltherrschaft: der „Untergang einer vom rigoristischen Strafgesetz dominierten Kulturordnung und deren Ersetzung durch eine neue, ‚moderatere‘“,20 geschildert aus der quasi-ethnologischen Sicht des „Forschungsreisenden“ – einer Figur, die auch „die Deformation des Beobachtungsgegenstandes“21 durch das „Paradox des ‚teilnehmenden Beobachters‘“22 thematisiert. Die einer Dialektik der Aufklärung sich verdankende Disziplinartechnologie jenes ancien régime, mit der ein weißer Offizier im Beisein seines Gastes einen anderssprachigen23 (’eingeborenen’?) Soldaten hinrichten möchte, verkörpert sich in einer Peepshow physischer Grausamkeit, die lange vor Georges Bataille Herrschaft als Sadismus (und Ekstase?) zur Schau stellt.24 In der unangenehmen Verdopplung des Gewalt-Voyeurismus in der „Pornologie“25 des Textes wird neben der Zuschauerfigur auch der/die Leser/in in eine kompromittierte Rolle gedrängt:26 „Through the figure of the Traveler […] the text turns the Western anthropological gaze upon itself to excoriate the barbarism of the supposedly enlightened Occident.“27
In Anlehnung an Hannah Arendts Kolonialismus-Analyse hat Peters darauf hingewiesen, dass „gemäß dem Gesetz des ‚Korrespondenzverhältnisses‘, [von ‚innen‘ und ‚außen‘, C.R.], das Kafkas Welt auszeichnet“, „der Prozeß unendlicher [kolonialer] Expansion hier weniger als ein äußerlicher und territorialer, denn als eine schier endlose Expedition […] ins Innere des Kolonialisierten geschildert“ werde.28 Diese psycho-physische Invasion ähnelt jener Einschreibung, als die David Spurr den Kolonialismus achtzig Jahre später beschrieben hat: „a form of self-inscription onto the lives of a people […]“29. Bei Kafka indes wird das koloniale Eindringen in den Körper nichts zutage fördern, denn das Gemüt des Verurteilten bleibt für die Umstehenden wie den Leser opak und wird nur durch die – möglicherweise unzulänglichen – Interpretationen seiner Reaktionen durch den Forschungsreisenden erschlossen. Ganz im Sinne von Gayatri Spivaks zentralem Text der Postcolonial Studies – Can the Subaltern Speak?30 – gibt es hier im Text keinen Raum, in dem sich der Verurteilte vernehmlich ausdrücken könnte, geschweige denn, dass ihn die Strafe mündig machen würde: Das, was er beispielsweise zum Soldaten sagt, bleibt für die immer weniger vertrauenswürdige Erzählinstanz ungehört, ja unerhört (vgl. IDS 51, 55).31
In der prächtigen Uniform des Offiziers, die „für die Tropen zu schwer“ ist (IDS 32, vgl. 33), kontrastiert mit der zu beschriftenden Nacktheit seines präsumtiven Opfers (IDS 41f.), wird so auch der Gegensatz von „savagery and civilization“ verhandelt.32 Dabei schreckt der Text ebenso wenig vor der verstörend teilnahmslosen Wiedergabe rassi(sti)scher Stereotypen33 zurück, wenn der „Verurteilte“ beschrieben wird:
[…] ein stumpfsinniger, breitmäuliger Mensch mit verwahrlostem Haar und Gesicht […]. Übrigens sah der Verurteilte so hündisch ergeben aus, dass es den Anschein hatte, als könnte man ihn frei auf den Abhängen herumlaufen lassen und müsse bei Beginn der Exekution nur pfeifen, damit er käme. (IDS 31)
So treffen gleichermaßen die Raffinesse des Henkers und seiner Maschine auf die stumpfe Indolenz des Delinquenten, dem auch noch eine defiziente Physiognomie und potenziell sogar Kannibalismus34 (vgl. IDS 37) nachgesagt werden. Schon diese Beschreibung stellt eine koloniale Hierarchie der Kulturen her, die zwischen ‚Herr‘ und ‚Knecht‘ differenziert, aber auch zwischen ‚Sauberkeit‘ und ‚Schmutz‘35: ein Gefälle, das in weiterer Folge freilich kollabiert – oder doch nicht?
Was nämlich folgt, ist die zunehmende Entropie bzw. Dysfunktion des „Apparats“ – und nicht nur Alexander Honold hat bereits auf die Doppeldeutigkeit dieses Terms hingewiesen, der sich sowohl auf die Maschine als auch auf das dahinter stehende bürokratische Disziplinarsystem beziehen lässt:36 Von Beginn an kämpft der Offizier der alten Schule gegen das reformerische Regime des neuen Kommandanten an, das sich seinen Methoden gegenüber distanziert verhält (vgl. IDS 33, 35). Auf der anderen Seite verweigert auch der Verurteilte allem Anschein nach den heiligen Ernst, den sich die Figuren, aber auch die Leser/innen als Reaktion auf seine bevorstehende Hinrichtung erwarten würden. Mehr noch, der Todeskandidat „ahmt[.]