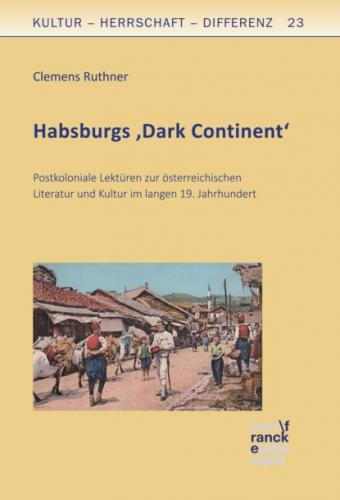Bei der Erschließung bosnischer Quellen haben mich meine wissenschaftlichen Hilfskräfte Asja Osmančević und Vikica Matić 2011 vor Ort in Sarajevo tatkräftig wie sprachmächtig unterstützt; große Inspiration kam auch von meinen bosnischen Studierenden in Sarajevo und Dublin über die Jahre hinweg. Ebenso muss ich mich für die kritische Lektüre von Rohfassungen meiner Buchkapitel bei Anna Babka (Wien), Marijan Bobinac und Ivana Brković (Zagreb), Gilbert Carr (Dublin), Hannes Leidinger (Wien), Martin Gabriel (Klagenfurt) und Vahidin Preljević (Sarajevo) ganz besonders bedanken – sowie für das Endlektorat bei Isabel Thomas (Halle/Dublin). Daneben schulde ich auch folgenden Institutionen Dank: der Filozofski Fakultet der staatlichen Universität von Sarajevo, dem German Department der UC Berkeley, der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien, der UB Wien und ihren angeschlossenen Germanistik- und Anglistik-Fachbibliotheken, der bosnisch-herzegowinischen Nationalbibliothek in Sarajevo, sowie dem Long Room Hub Arts & Humanities Research Institute und dem Dept. of German Studies am Trinity College in Dublin.
Auch ohne zeitweiligen Ortswechsel wäre ein derartiges Projekt mental wohl nicht realisierbar gewesen – in diesem Sinne bin ich auch äußerst dankbar für den genius loci, der mich verschiedentlich, so z.B. als Gastprofessor in Bosnien und Kalifornien, umgab. Er ist wichtig für das geistige Überleben der ehemaligen Geisteswissenschaften, denn manchmal braucht auch unsereins Inspiration.
Als größter Anreiz für das Gelingen dieses Projekts erwies sich freilich, dass es im Leben noch wichtigere Anlässe als deadlines für Bücher gibt – wie z.B. eine Geburt. In diesem Sinn geht, last but not least, mein liebevoller Dank an Christina Töpfer und unsere Tochter Juli Ariane: dafür, dass sie da sind und mit mir Geduld haben. Ebenso an meine Mutter Sigrid Ruthner, ohne deren großzügige Unterstützung es wohl auch nicht möglich gewesen wäre, dieses Projekt erfolgreich abzuschließen.
Berkeley – Dublin – Graz – Opatija – Penk – Wien, 2015–2017
„Wir machen aber von dem Länderreichtum des Ich viel zu kleine oder enge Messungen, wenn wir das ungeheure Reich des Unbewußten, dieses wahre Innere Afrika, auslassen.“
(Jean Paul, Selina, 1827)
Teil A: Instrumentarium
A.0. BestandsAufnahmen:
Postkoloniale Zugänge in der (Österreich-) Germanistik – Forschungsstand & Projektskizze
Die Literatur Europas ist die eines Kontinents von Kolonisatoren. Meistens ist der Kolonialismus in der Literatur ‚Hintergrundphänomen‘, d.h. er wird nicht wahrgenommen, gehört zum selbst verständlichen Bestand des europäischen Weltbildes.1
1. Weiße Flecken am dunklen Kontinent: der Kolonialismus & Österreich
Das hier als Motto vorangestellte Zitat des Komparatisten Janós Riesz entstammt einem der ersten deutschsprachigen Sammelbände zum Thema Literatur und Kolonialismus aus dem Jahr 1983 – und es spricht paradigmatisch die selektive Wahrnehmung an, die das Phänomen lange umgab und teilweise immer noch umgibt. Die akademische Auseinandersetzung damit begann zwischen den 1950er und 1970er Jahren in Frankreich, Großbritannien und den USA unter dem Eindruck der weltweiten Dekolonisation – vor allem angesichts der Gräueltaten des Algerien- und Vietnam-Kriegs, aber auch durch die intellektuellen Interventionen eines Frantz Fanon, Jean-Paul Sartre, einer Hannah Arendt u.a., durch die entstehenden britischen Cultural Studies und die sich später formierenden amerikanischen Postcolonial Studies.1 Die ideengeschichtliche Folie dafür lieferte die Imperialismus-Kritik der westlichen Linken vor allem der 1968er-Generation; aus ihr heraus sollte bald – zusammen mit neuen, postmarxistischen Begrifflichkeiten – eine spezielle Sensibilität für jene Form einer entmündigenden bzw. bevormundenden Übersee-Herrschaft unter dem trügerischen Vorzeichen der europäischen Moderne entstehen. Nicht nur in den ehemaligen Mutterländern, die sich mit zunehmender politischer Bedeutungslosigkeit bei gleichzeitiger Massenimmigration konfrontiert sahen, sondern v.a. auf dem Grundgebiet der neuen Supermacht USA sowie in einigen anderen ehemaligen Kolonien etablierten sich entsprechende Forschungseinrichtungen, wie z.B. in Indien die Subaltern Studies Group oder eine lateinamerikanische Spielart der Kulturtheorie. Schließlich erfasste diese zweite Welle einer internationalen Vergangenheits(selbst)bewältigung nach dem Zweiten Weltkrieg auch kleinere ehemalige Kolonialmächte wie Belgien, Portugal oder Italien, wenn auch zögerlich: werden doch die Verbrechen und das Scheitern des Kolonialismus immer noch gleichsam als Bildstörungen der eigenen nationalen wie kontinentalen Erfolgsgeschichte angesehen.
Auf der Europakarte eines neuen postkolonialen Bewusstseins blieben indes einige weiße Flecken zurück, darunter Österreich: „Forschungsgeschichtlich“, so moniert der Wiener Historiker Walter Sauer selbst erst nach der Jahrtausendwende,
ist die Frage nach dem Verhältnis der [Habsburger] Monarchie zur Kolonialproblematik zwar nur selten gestellt, aber um so häufiger beantwortet worden: Nein, über Kolonien habe Österreich-Ungarn nie verfügt, koloniale Ambitionen habe es nur am Rande gegeben, kolonialpolitisches Desinteresse gerade sei für das Verhalten von Österreichern in außereuropäischen Gebieten charakteristisch gewesen. […] Es entsprach einer in großbürgerlichen Kreisen um die Jahrhundertwende verbreiteten Tendenz, das Scheitern früherer Ambitionen auf ein ‚Kolonialreich‘ zur bewußten Zurückhaltung, zur moralischen Überlegenheit der Monarchie zu stilisieren. […] Gegenüber sich selbst, aber auch gegenüber einer ‚Dritten Welt‘, die sich vom kolonialen Joch zunehmend emanzipierte, stellte sich [auch] das neue Österreich [= die Zweite Republik ab 1945, C.R.] als unbelastet dar.2
Die Habsburger Reich, d.h. jenes „Kaisertum Österreich“, das nach dem „Ausgleich“ von 1867 international unter dem Etikett von „k.u.k.“ (’kaiserlich-und-königlich’) bzw. als „Österreich-Ungarn“ firmierte, hatte in der Tat keine Übersee-„Schutzgebiete“ wie das benachbarte Deutsche Reich seit 1884: Aber ist nicht seine letzte territoriale Erweiterung nach Südosten hin (Bosnien-Herzegowina 1878/1908) nicht auch als Ersatzhandlung für jenes Zukurz- bzw. Zuspätkommen im internationalen Wettlauf des europäischen Kolonialismus zu verstehen – ebenso, wie vielleicht auch Galizien, die Bukowina und andere habsburgische Peripherien seit dem späten 18. Jahrhundert dafür in Betracht kämen? Und, allgemeiner gesprochen: Welche Spuren bzw. „Parallelaktionen“ hat der zeitgenössische Kolonialismus Europas im „politischen Unbewussten“ bzw. „sozialen“ Imaginären“3 der habsburgischen Kultur/en hinterlassen? Diese Fragen werden uns – unter Anderem – im Laufe dieses Buches beschäftigen.
Mit seiner Metapher vom „dark continent“,4 die unserer Monografie ihren Titel gab, meint Sigmund Freud freilich nicht jene verdrängte innere und äußere k.u.k. Kolonisierung,5 sondern „das Geschlechtsleben des erwachsenen Weibes“6 in seiner eigenen Kartografie der menschlichen Psyche – in die seine Lehre ebenso wie in das „Unbewusste“ generell mit uneingestanden kolonialen Wünschen vordrang.7 Das gendering ist evident: der Wiener Mann gibt sich als Entdeckungsreisender auf dem ‚dunklen Kontinent‘ der Frau. Wollte die Psychoanalyse hier nicht nur ihr Revier im wissenschaftlichen Wettrüsten ihrer Zeit – einer Nebenerscheinung des europäischen Imperialismus im 1900 – abstecken, sondern gleichsam auch ihre mentalen Schutzgebiete errichten (ähnlich wie der westliche Kolonialismus trachtete, nicht nur das materielle und soziale Außen der Menschen, sondern auch ihr psychisches Innen zu besetzen und zu manipulieren)?
Was uns im vorliegenden Buch beschäftigen soll, sind aber nicht die metaphorischen Expeditionen der Psychoanalyse,