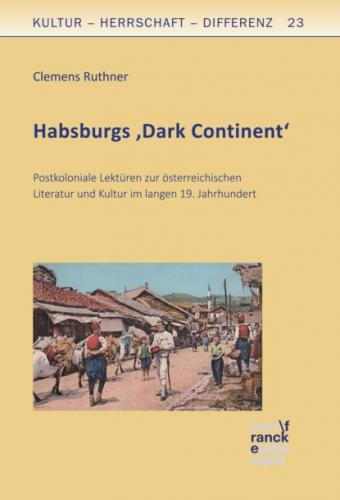Anfangs lacht der Protagonist noch
über diese Sorte von Humor, aber eines Tages fiel es ihm plötzlich auf, was für ein Sinn darin lag. War’s nicht der nämliche Sinn, in welchem er selbst Herrn Staunton gegenüber sich der Ironie bediente? Tat das der Neger nicht auch, indem er die weiße Rasse verspottete durch die Selbstverspottung seiner schwarzen? Welch gleichartiger Instinkt waltete hier? (AM 89)
Moorfeld wird im Roman zum guten Deutschen jener Epoche stilisiert und ist somit auch ein erklärter Gegner der Sklaverei (vgl. etwa AM 232ff.) – wiewohl nicht ganz gefeit vor „Neger“-Stereotypen, die sich immer wieder, wie etwa auch in den zitierten Passagen deutlich wird, in seine Figurenperspektive stehlen.4 Der Bruch mit diesem Stereotyp erfolgt indes durch das Verhalten des Afroamerikaners, der sich der Trope der Ironie fähig zeigt, indem er sich in die Sprecherrolle seines Herrn versetzt, sich selbst als „Esel“ beschimpft und damit die sozial fixierten Rollen von sprechendem Subjekt und besprochenem Objekt aufbricht. Es ist dies einerseits ein Modellfall der Internalisierung diskriminierender Fremdbilder durch die Betroffenen, die andererseits im spielerischen Umgang damit aufgehoben wird – ein Prozess, der ziemlich genau dem entspricht, was Bhabha „Mimikry“ nennt. Dies destabilisiert aber nicht nur die Autorität von Mr. Staunton, Jacks weißem Herrn, sondern in weiterer Folge auch die Identität des deutschen Beobachters Moorfeld, der zu folgender Reflexion anhebt:
Ist die Ironie die Muttersprache unterdrückter Nationalitäten? Und wie ward unserem Freund, als er an Europa zurückdachte und bemerken mußte, daß eben jetzt die Ironie die herrschende Form der europäischen Literatur, aber auch ein Weltschmerz, Polenschmerz, Judenschmerz der herrschende Inhalt war? War er den Übeln, die man für Übel nur der Alten Welt hielt, nicht entronnen, und fand er in der Neuen Welt etwa einen Deutschen- und Negerschmerz? Verhängnisvolle Fragen. (AM 89)
Moorfeld, der Deutsche aus der Revolutionszeit um 1848, der sich im Allgemeinen unterschwellig als Angehöriger eines ‚Kulturvolks‘ überlegen weiß (wenngleich in der alten Heimat von seinesgleichen politisch anachronistisch unterdrückt), nimmt in der sozial-ethnischen Hierarchie der fiktional konstruierten Neuen Welt eine merkwürdige Mittelstellung zwischen dem gebürtigen Amerikaner und dessen schwarzem Sklaven ein. Immer wieder thematisiert der Roman die betrügerische, großmäulige und unkultivierte Haltung5 seiner „Yankee“-Figuren gegenüber den deutschen Einwanderern (vgl. z.B. AM 157), die jenen in der narrativen Logik des Textes zwar moralisch und kulturell etwas voraushaben, sich aber trotzdem sozial den realen Macht-Verhältnissen fügen müssen.6 (Nicht umsonst erzählt der Roman in einer bitteren finalen Wendung von gewalttätigen Ausschreitungen eines amerikanischen mob gegen die deutschen underdogs in New York; vgl. Kap. III.5, AM 554–562.)
In dieser Bedrängnis durch die widrigen Umstände lernt der Deutsche – der später durch juristische Spitzfindigkeiten um seinen neuen Landbesitz in den USA gebracht wird – schon bald vom afrikanischen Sklaven. Mehr noch, er identifiziert diesen mit Gruppen, auf die er in der Heimat selbst herabgeblickt haben mag, nämlich Polen und Juden (vgl. AM 442), um schließlich im „Negerschmerz“7 seinen eigenen – und sich selbst – wiederzufinden. Dies betont im Rekurs auf die Opfer der Sklaverei trotzig die eigene moralische Überlegenheit als Selbst-Behauptung entgegen einer als diskriminierend empfundenen sozialen Unterlegenheit.8 Dabei suggeriert die Rhetorik des Wortes „(wieder)finden“ etwas nur halb Richtiges, denn eigentlich verliert sich der Deutsche in diesem Moment, in dem alle ethnisch kodierten und von realen Machtzuständen getragenen identitären Verhältnisse in der Form uneigentlichen Sprechens kollabieren – in der Ironie, in dem von ihr antizipierten „Weltschmerz“ und im Bewusstsein: „Amerika ist ein Vorurteil“ (AM 337).
Wohl kommt es immer wieder zu einer kurzfristigen Restabilisierung und Re-Ethnisierung der Positionen in Passagen, wo Identifizierbarkeit entgegen allen ‚unzivilisierten‘ Umständen des amerikanischen Pionier-Daseins trotzig behauptet wird – und mit ihr die stereotypen Epitheta:
Die Gesichter blickten verwittert, verwildert, vertiert [!] mitunter und ließen mich häufig, unterstützt zumal durch die zigeunerhafte [!] Unbestimmtheit der Kleidungsstücke, zwischen männlichen und weiblichen irren. Desto merkwürdiger scharf zeichneten sich die Nationalitäten. Der spintisierende Amerikaner, der phlegmatische Deutsche, der heißköpfige Irländer wurden auf den ersten Blick herausgefunden. (AM 407f., Hervorh. C.R.)
Die ebenso thematisierte Unterminierung und Destabilisierung ist jedoch bei aller Apologie des ‚Nationalcharakters‘ und insbesondere eines ‚besseren‘ Deutsch-Seins nicht aufzuhalten. Die letzte Pointe dieses Prozesses aufzufinden obliegt freilich nur einem historisch bewussten Leser: Denn eigentlich ist der Protagonist des Romans, der auf 560 Seiten strategisch amerikanische und deutsche Art und Unart narrativ gegeneinander aufrechnet (bis ihn der Text von der utopischen Hoffnung auf eine bessere Neue Welt kuriert in die fragwürdige Heimat zurückschickt), gar kein Deutscher im engeren Sinn! Er entstammt vielmehr einer deutschsprachigen Minderheit von den Rändern des Habsburger Reiches und weiß sich dem Ungarn fast ebenso nahe (vgl. AM 67f.) wie den Deutschen, die er in New Yorks Little Germany trifft (vgl. Kap. I.6 u. III.1), vielleicht in seiner Liebe für ein gutes „Golasch“ sogar näher.9 Damit erweist sich die ‚deutsche‘ Nabelschau des Romans aber als Spiegelfechterei gegenüber den Realitäten des österreichischen Vielvölkerstaats; die Mimikry beherrscht der ungarndeutsche Protagonist und mit ihm der Erzähler ebenso wie der Hausdiener Jack, wenn dieser schwarzes Objekt und weißes Subjekt strategisch ironisch vertauscht. Moorfeld wird sich selbst in Amerika ein Anderer, und seine Identität ist ein noch prekäreres Unterfangen geworden, als sie dies ohnehin schon war – und diese Hinterfragung kann wohl als das didaktische Ziel ‚guter‘ Literatur generell gelten.
9. Abschluss & Ausblick
Egal, wie hoch man nun – mit Bhabha – den subversiven Faktor oder – mit Foucault bzw. Said – die repressive Wirkungsmacht ethnischer, sozialer oder geschlechtlicher Stereotypen für die Formierung von Identitäten ansetzt, bleibt doch für eine narratologisch inspirierte kulturwissenschaftliche Forschung von Belang, dass solche Bildformungen prinzipiell auch in literarischen Texten niemals ‚unschuldig‘ (wenn auch mitunter ‚unbewusst‘) und schon gar nicht ‚interesselos‘ sind. In der Reiseliteratur stammen sie meist weniger aus einer erfahrenen Realität, sondern vielmehr aus der Intertexualität, und sind von dort in die ‚Wirklichkeit‘ projiziert, d.h. hineingelegt worden; sie helfen mit, diese zu konstruieren. Dies wird etwa bei einer prominenten Orientreise der Jahrhundertwende explizit, jener von Walter Rathenau, wenn sich der „Großschriftsteller“ beklagt:
Nun der Orient! Nach drei Tagen läßt sich nicht viel urteilen, aber soviel scheint mir: Leben und Menschen sind interessant. Landschaft, Kunst, Publikum nicht überwältigend. Was ich erwartete, finde ich vollständig; ein semitisches Volk in Freiheit dressiert, polnische Juden im unverkümmerten Zustand. Die Straßen und Basare genauso, wie du sie dir vorstellst, Esel, Kamele, Menschen, Verkäufer, Kinder, vermummte Frau[en], Geschrei, Gestank, Sonne, Hitze – kurz es stimmt alles.1
Der Reisende findet und schreibt, was er aus anderen Texten kannte, ja er projiziert sogar die kulturellen Differenzen ‚seines‘ Zentraleuropas in den Orient – und „es stimmt alles“.2 Aber was ist dann die Aufgabe der Forschung angesichts dieser Zirkularität von Erwartungshorizont und Realitätskonstruktion im Narrativ? Konkret aufgezeigt werden kann die Verortung der Stereotypen in einer konkreten historischen Situation und ihre prinzipiell ambivalente Anlage, analog der ihnen zugrunde liegenden Dialektik von Angst/Begehren und epistemischer Kontrolle, die wohl charakteristisch ist für jede Annäherung an das/die Fremde in der westlichen Moderne:3 So oszilliert denn das Bild des Anderen meist zwischen dem des schrecklichen Barbaren und jenem des ‚edlen Wilden‘, von dem man ein ‚besseres Leben‘ lernen kann, oder der ‚schönen Fremden‘, der(en) sich der westliche Mensch – oder vielmehr meist: Mann – (sexuell) bemächtigen möchte.4
Weiters ist auffällig,