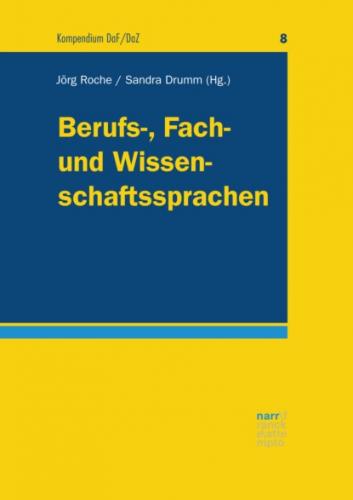Für den Fremdsprachenunterricht ist bedeutsam, dass unterschiedliche Abstraktionsstufen in den Unterricht eingebunden werden. Fachleute müssen stets auf mehr als einer Ebene sprachlich kompetent sein, da sie mit Personen der anderen Ebenen kommunizieren müssen. Daher sollten Texte unterschiedlicher Zielrichtung für ein Fachgebiet ausgewählt und behandelt werden. Das sind einerseits theoretische Beispiele, aber andererseits auch praktische Handreichungen.
Bei der Einteilung von Fachsprachen tritt ein Problem auf, dass auch für den Unterricht bedeutsam ist. Die Einteilung wird von Sprachforschern und Sprachforscherinnen vorgenommen, die in erster Linie Linguisten und Linguistinnen sind. Bezogen auf das Fach und dessen Inhalte stellen sie aber häufig Laien dar. Die genannten Einteilungen entbehren also häufig einer Insiderperspektive. Auch Sprachlehrerinnen und Sprachlehrer besitzen in der Regel nicht die fachliche und fachkommunikative Kompetenz im betreffenden Fach, die nötig wäre, um die Ausrichtung des Unterrichts auf die fachlichen Inhalte sinnvoll zu gestalten. Umgekehrt verfügen die inhaltlichen Experten und Expertinnen des Faches nur in seltenen Fällen über die nötige sprachdidaktische Kompetenz, um die sprachliche Seite des Faches zu vermitteln (vergleiche Roche 2003: 153). Es stellt sich also die Frage, wie viel Fachwissen der Sprachunterricht benötigt, um fachbezogen Sprachkenntnisse zu vermitteln. Wenn Sie bereits fachorientierten Sprachunterricht gegeben haben, kennen Sie diese Problematik sicher aus Ihrem eigenen Unterricht.
Da wir Sprachlehrkräfte häufig weniger über das Fach wissen als unsere Lerner, ist es sinnvoll, diese als Experten und Expertinnen für die fachlichen Gegenstände in den Unterricht einzubeziehen. Bevor fachliche Texte und Kommunikationssituationen behandelt werden, kann es ertragreich sein, zuerst die Ziele des Faches (abgesehen von Sprache lernen) zu thematisieren. Was wird im Fach auf welche Weise getan und welche Mittel werden dabei verwendet? Was sind zentrale Textsorten? Anhand dieser gemeinsam erarbeiteten Zielsetzungen können dann sprachliche Mittel gesucht und begründet werden. Dennoch ist es für uns Lehrkräfte ebenso sinnvoll, das Fach, dessen Sprache gelernt werden soll, vor dem Beginn des Unterrichts grob einzuteilen. Roelcke (2010) präsentiert ein Modell der Einteilung von Fachsprachen, das sowohl horizontale als auch vertikale Zuteilungen ermöglicht. Es hat den Vorteil, dass es abstrakt genug bleibt, um handhabbar zu sein, aber genau genug unterteilt, um eine Vorstellung von der Fülle der fachsprachlichen Varianten zu vermitteln.
Gliederung der Fachsprachen (Roelcke 2010: 31)
Fachsprachen lassen sich demnach grob unterteilen in Theorie- und Praxissprache. Die Theoriesprache wiederum betrifft vor allem die Fachsprache der Wissenschaft, die ihrerseits in die beiden Bereiche Natur- und Geisteswissenschaft unterteilt werden kann. Ein Teil der Theoriesprache betrifft auch die Sprache der Technik, besonders da auch Technik mittlerweile wissenschaftlich aufgearbeitet wird.
Wie wir gesehen haben, lassen sich fachsprachliche Erscheinungen auf unterschiedliche Arten und Weisen gruppieren und einer Analyse zugänglich machen. Dazu zählt auch die Einteilung in Textsorten, die im Fach Verwendung finden.
1.2.3 Fachliche Textsorten
Als Textsorte bezeichnet man eine Gruppe von Texten, die bestimmte Eigenschaften gemeinsam haben, die sie von anderen unterscheiden. So sind Briefe zum Beispiel immer mit einer Anrede und Grußformel versehen, Gesetzestexte hingegen nicht. Die Eigenschaften können textexterne und textinterne Kriterien sein. Textexterne Kriterientextexterne Kriterien sind zum Beispiel die Textfunktion, der Kommunikationskanal und die Kommunikationssituation, in der ein Text entsteht. Textinterne Kriterientextinterne Kriterien sind zum Beispiel der Wortschatz und das Satzbaumuster.
Beispiel zur Bestimmung von fachlichen Textsorten (Bayer 2015)
Bei diesem Textausschnitt handelt es sich ganz eindeutig um eine Packungsbeilage, die die Einnahme eines Medikaments erläutert und auf eventuelle Risiken hinweist. Typisch für die vorliegende Textsorte ist die Unterteilung in Zweck des Medikaments und zu beachtende Punkte.
Textinterne Kriterien sind die immer wiederkehrende Wiederholung des Markennamens Aspirin, bestimmte Floskeln (vor der Einnahme), Fachwörter (Acetylsalicylsäure) und die Nutzung von zahlreichen Aufzählungen. Die textexternen Kriterien orientieren sich am Kommunikationszusammenhang.
Dazu zählen vor allem die Textfunktionen „Medikamentenbeschreibung“ und „Einnahmehinweise“, das Trägermedium „Beipackzettel aus Papier“ und die Kommunikationssituation, bei der die Akteure der Kommunikation sich nicht in derselben Situation aufhalten. Daher muss der Text so verfasst sein, dass er ohne die Möglichkeit Nachfragen zu stellen verstanden wird.
In Fachsprachen verwendete Textsorten sind an den fachlichen Inhalt gebunden und weisen innerhalb der fachlichen Kommunikation jeweils bestimmte funktionale und formale Gemeinsamkeiten auf (vergleiche Roelcke 2010: 40f). Dabei können Fachtexte unterschiedlich abstrakt sein, sie lassen sich also ihrerseits auf der vertikalen Achse der Fachsprachengliederung einsortieren. Sie unterliegen aber auch bestimmten fachbezogenen Traditionen, sind also auch auf der horizontalen Gliederungsebene verortet.
Es gibt jeweils eher zentrale und eher randständige Vertreter einer Textsorte. Texte, die unter den gegebenen kommunikativen Bedingungen für die fachliche Verständigung besonders geeignet sind, gelten als prototypisch für die Textsorte. Die oben gezeigte Packungsbeilage kann als prototypisch angesehen werden. Prototypen sind gut geeignet, um Fachsprache zu vermitteln, da die immer wieder kehrenden Muster in Textsorten sich als Vorbild für die eigene Produktion von Texten der Lerner eignen. Sie stellen sprachliche Handlungsmuster dar, die Zweck, Zielgruppe und Abstraktionsgrad der Fachkommunikation bündeln und zur Nachahmung bereitstellen.
In Bezug auf die Übertragung fachlichen Wissens von Experten und Expertinnen auf Laien sind besonders die Textsorten der fachexternen Kommunikation und Konsumption interessant. Es lassen sich in Fachtexten unterschiedliche Funktionen ausmachen, die diese für die Laien übernehmen sollen. Didaktisierte Texte haben zum Ziel, Wissen aufzubauen und Kenntnisse zu vermitteln, während Ratgebertexte eher Anleitungscharakter haben. Produktbegleitende Texte und Werbetexte hingegen haben auffordernden Charakter.
Der Lehrbuchtext führt neue Themen (ph-Wert) ein und definiert sie in möglichst einfachen Worten. Dies wird grafisch durch einen Absatz hervorgehoben. Danach wird die Beschreibung ausgeweitet und Anwendungswissen vermittelt, indem auf Dinge Bezug genommen wird, die die Lerner aus dem Alltag kennen (Sprudelwasser, Magensaft). In jüngster Zeit befasst sich die Fachsprachenforschung vermehrt mit der Analyse der Prozesse und Strategien zur Vermittlung fachlichen Wissens und fachlicher Fähigkeiten. Dabei ist zentral, dass diese Vermittlung nicht unilateral erfolgt, also nicht nur von den Expertinnen und Experten hin zu den Laien, sondern dass auf beiden Seiten aktive Prozesse stattfinden. Laien bringen Vorkenntnisse in den Kommunikationsakt mit ein und sind aktiv am Erwerb neuen Wissens und neuer Fähigkeiten beteiligt. Lehrbuchtexte greifen dieses Wissen auf und binden es ein.
Es lässt sich hier bereits absehen, dass die Analyse und Einteilung fachlicher Texte immer abhängig von deren Funktion ist. Dem wollen