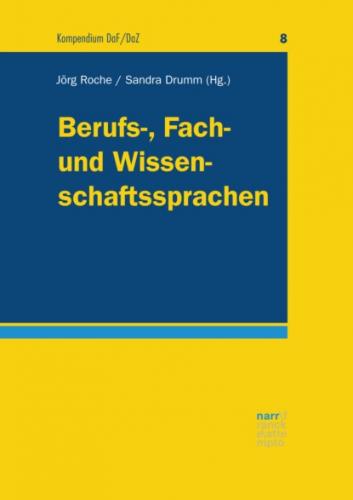Sprachliche Spezifika von fachsprachlichen Handlungen
Eine zentrale Sprachhandlung, die in Fachsprachen realisiert wird, ist das Definieren, häufig unter Zuhilfenahme von TerminologisierungTerminologisierung, also die Zuordnung eines bestimmten Begriffs zu einer feststehenden Bedeutung. Substantive in fachsprachlichen Texten liegen zumeist in der Form solcher TerminiTerminus vor, die als „die kleinste bedeutungstragende und zugleich frei verwendbare sprachliche Einheit eines fachlichen Sprachsystems, die innerhalb der Kommunikation eines bestimmten menschlichen Tätigkeitsbereichs im Rahmen geäußerter Texte gebraucht wird“ (Roelcke 2010: 51f), definiert werden können. Ein TerminusTerminus dient der Ordnung der Welt in Kategorien. Er ist einerseits mit einer vergleichsweise kurzen Benennung verbunden, andererseits mit einer Beschreibung der bezeichneten Kategorie. Die DefinitionDefinition ist die strengste Form der facheigenen inhaltlichen Festlegung (vergleiche Fluck 2010: 479). Der Terminus ist eine Bezeichnung für eine Reihe ähnlicher Sachverhalte beziehungsweise eine allgemeine Vorstellung dessen, was mehrere Objekte gemeinsam haben.
Termini ändern sich mit dem Fortschreiten der technischen und wissenschaftlichen Entwicklung, doch es kann auch vorkommen, dass ungenaue oder widerlegte Begriffe als Termini verbleiben, weil sie so gut etabliert sind. Der Begriff Atom beispielsweise (von griechisch ἄτομος átomos‚ ‚unteilbar‘) bezeichnet die Bausteine, aus denen alle festen, flüssigen oder gasförmigen Stoffe bestehen. Ursprünglich galten sie als die kleinsten Einheiten aller existierenden Stoffe. Später stellte sich jedoch heraus, dass sie nicht unteilbar sind, wie zum Zeitpunkt der Namensgebung angenommen, sondern aus noch kleineren Teilchen bestehen. Ausschlaggebend für die Terminologisierung ist also der jeweilige fachwissenschaftliche Entwicklungsstand, aber auch die fachsystematische Zuordnung der Bedeutung (vergleiche Fluck 2010: 479). Viele Termini der Fachsprachen sind auf die klassischen Fremdsprachen Latein und Griechisch zurückzuführen, im Bereich der neueren Entwicklungen auch auf das Englische. Doch nicht nur fremdsprachliche Begriffe bilden den Wortschatz der Fachsprachen. Auch allgemeinsprachliche Wörter können in spezialisierter Bedeutung verwendet werden, was gelegentlich Mehrdeutigkeit von Fachbezeichnungen verursacht.
Strom z.B. ist innerhalb der Physik [ein] Fachwort der Mechanik, der Wärmelehre und der Elektrotechnik, dazu auch Fachwort der Geographie. Diese Polysemie wirkt sich indes kaum störend aus, da in der fachlichen Kommunikation – wenn Bedarf besteht – die einzelnen Bezeichnungen mit attributiven Erläuterungen oder Bestimmungshinweisen versehen werden (wie zum Beispiel elektrischer Strom, dauernde Ströme, Gleichstrom, Wechselstrom). (Fluck 2010: 479)
Der Aufbau der Definition orientiert sich an der aristotelischen Form. Diese besteht aus einem Definiendum (der zu definierende sprachliche Ausdruck), einem Definitor (Verbindungsglied) und einem Definiens (der definierende sprachliche Ausdruck). Letzteres beinhaltet zwei Teile, nämlich die Angabe der Gattung und die Angabe der artspezifischen Merkmale (vergleiche Roelcke 2010: 54f). Die jeweilige Benennung steht abstrakt für alle Vertreter, die dieselben Merkmale aufweisen. Solche Merkmale werden als kritische Attribute einer Sache bezeichnet:
Der Begriffsinhalt ist die Summe aller kritischen, das heißt gemeinsamen Attribute eines Begriffs. […] Der Begriffsumfang ist die Gesamtheit aller in einem Begriff zusammengefaßten Ereignisse. (Graf 1989: 13f)
Eine Definition beschreibt also einen Sachverhalt durch die Nennung der für den Begriff charakteristischen Merkmale. Sehen wir uns dazu ein Beispiel (nach Wikipedia 2017) aus dem Fach Biologie an:
Das Reh (Capreolus capreolus) ist in Mitteleuropa der häufigste und gleichzeitig kleinste Vertreter der Hirsche. Das Reh besiedelte Waldrandzonen, kommt mittlerweile aber auch in fast deckungsloser Agrarsteppe vor. Aufgeschreckte Rehe suchen gewöhnlich mit wenigen, schnellen Sprüngen Schutz in Dickichten, es wird deswegen und auf Grund einiger morphologischer Merkmale dem sogenannten Schlüpfertypus zugerechnet. Rehe sind Wiederkäuer.
Reh (Definiendum) wird hier klassisch aristotelisch definiert, indem Definitor (ist) und ein Definiens (in Mitteleuropa der häufigste und gleichzeitig kleinste Vertreter der Hirsche …) benannt werden. Letzteres beinhaltet die Angabe der Gattung und die Angabe der artspezifischen Merkmale. In diesem Sinne ist das Reh in der spezifischen Form Capreolus capreolus durch die kritischen Attribute Lebensraum (Mitteleuropa, besiedelte Waldrandzonen, Agrarsteppe) und Körpergröße (kleinster der Hirsche) definiert. Dies dient gleichzeitig der Einordnung in ein Netz von zusammenhängenden Begriffen, im vorliegenden Fall der Artzugehörigkeit zur Gruppe der Hirsche.
Viele Fachsprachen basieren auf einer solchen terminologischen Festlegung von Bedeutungen. Wie wir im nächsten Kapitel sehen werden, dient dies bestimmten sprachlichen Funktionen und Zielen. An dieser Stelle soll zunächst jedoch die Überlegung angestellt werden, warum wir überhaupt fachsprachlichen Fremdsprachenunterricht brauchen. Wenn Begriffe und Bedeutungen eindeutig einander zugeordnet sind, wäre es dann nicht viel einfacher eine weltweite Fachsprache – möglicherweise das Englische – zu vermitteln, um so die Eindeutigkeit zu verstärken? Es lässt sich nicht leugnen, dass im Zuge von Internationalisierung und Globalisierung Englisch als Arbeits- und Kommunikationssprache zunimmt. Es werden vermehrt englischsprachige Studiengänge angeboten und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schreiben Fachtexte zunehmend auf Englisch. Es erscheint zunächst praktisch: Internationale Studierende lernen im Herkunftsland Englisch und können dann in jedem Land, in jeder Kultur studieren, arbeiten und mit Menschen in Kontakt treten. Doch so einfach scheint die Sache mit den Sprachen nicht zu sein.
Für die Fachwissenschaften wird häufig gefordert, dass eine einheitliche Wissenschaftssprache bestimmt werden soll, um die Kommunikation über Sachverhalte zu vereinfachen und genauer werden zu lassen. Dieser sprachrealistische Ansatz geht davon aus, dass die Welt durch Begriffe direkt vermittelbar ist und Sprache lediglich diese neutrale Mittlerfunktion innehat. Sprache soll den Erkenntnisgewinn und die Kommunikation nicht behindern, daher wird aus dieser Perspektive für eine einheitliche Wissenschaftssprache plädiert. Zum einen sollen alle Menschen diese Sprache als Fremdsprache möglichst früh und umfassend erlernen, zum anderen sollen alle Texte in diese Sprache übersetzt, Konferenzen und Meetings in dieser Sprache abgehalten werden. Die Idee ist, dass in dieser Fremdsprache alle Menschen einheitlich kommunizieren können, was die Teilhabe an gesellschaftlichen Entwicklungen von der Kultur entkoppelt und global verfügbar macht. Damit sind jedoch drei Problembereiche verbunden.
Kulturelle Dimensionen fachsprachlicher Kommunikation
Wie wir eingangs am Beispiel der Busfahrt gesehen haben, sind kulturell unterschiedliche Konzepte immer in Sprache mittransportiert – Sprache ist also nie neutraler Übermittler von Sachverhalten. Außerdem entwickeln sich Sprachen kontinuierlich weiter, und zwar ebenfalls abhängig vom Umfeld, in dem sie gesprochen werden. Demnach besteht trotz der hohen Zahl an Englisch sprechenden Personen auf der Erde keine Übereinstimmung in diesem Englisch. Zudem verändert sich eine Sprache, wenn sie in einem bestimmten Bereich lange verwendet wird. Wird eine Sprache in eine Kultur mit einer bestehenden Sprache eingebracht, verändern sich aber auch Bedeutung und Verwendung von Begriffen im Laufe der Zeit. Englisch ist als Erbe der britischen Kolonialzeit neben Swahili eine der beiden offiziellen Amtssprachen Kenias. Doch durch die unterschiedliche Lautgestalt der Erstsprachen (Kenia kennt mehr als zehn Erstsprachen neben Swahili und nahezu alle Menschen dort sind mehrsprachig) verändern sich die Aussprache des Englischen und nach und nach auch die Wortform. Auch die Bedeutung der Begriffe verändert sich, da in einem anderen Umfeld andere Konzepte damit verknüpft werden. Fachkommunikation basiert aber auf möglichst klarer begrifflicher Trennung und Eindeutigkeit. Reibungslose Verständigung zwischen Fachleuten, wie sie durch die weltweite Verbreitung des Englischen als Arbeitssprache gefordert wird, scheint eine Illusion zu sein, selbst wenn eine Lingua Franca seit der frühen Kindheit miterworben wird.
Doch auch Übersetzungen in eine Sprache, die möglichst viele Menschen beherrschen, sind nicht das Mittel der Wahl, denn häufig werden Begriffe nicht korrekt übersetzt und sind dann nicht mehr so trennscharf und genau wie das Original. Die im deutschen Journalismus