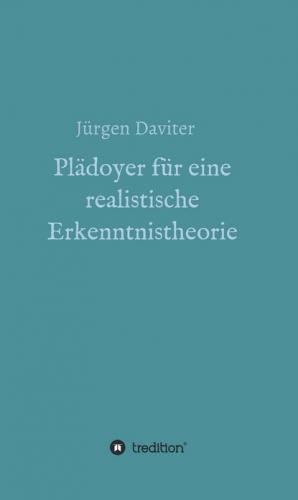(4) Humes Ideen zur empirischen Forschung
Tatsächlich fragt sich Hume in dem Abschnitt „Über die Vernunft der Tiere“‚ „wie es kommt‚ dass die Menschen die Tiere in ihrem Denken so sehr übertreffen und ein Mensch einen anderen so sehr übertrifft? Hat nicht dieselbe Gewohnheit denselben Einfluss auf alle?“ (EHU‚ S. 273 unter *.) In der Beantwortung dieser Frage (EHU‚ S. 273 f. unter *) geht er auf die unterschiedlichen „Verstandesausstattungen der Menschen“ ein.
-Manche Menschen nehmen „bereits eine einzige Erfahrung als Grundlage des Denkens und erwarten mit einiger Gewissheit ein ähnliches Ereignis“. Aufmerksamkeit‚ Gedächtnis und Beobachtungsgabe seien dabei wichtig.
-Andere Menschen können „verwickelte Ursachen“ und deren Gesamtzusammenhang besser begreifen.
-Wieder andere können „eine Kette von Folgerungen weiter verfolgen als ein anderer.“
-„Der Umstand‚ von dem die Wirkung abhängt‚ ist häufig mit anderen fremden und äußeren Umständen verquickt. Seine Abtrennung erfordert oft große Aufmerksamkeit‚ Genauigkeit und Scharfsinn.“
Hier finden wir bereits auf dem Gebiet des Alltagsverstandes zentrale methodologische Aspekte der empirischen Wissenschaften: durch wenig sich anregen lassen‚ eine Hypothese zu entwickeln‚ versuchen‚ Kausalfaktoren zu isolieren‚ und eine Kausalkette nach hinten verfolgen. In der Hauptsache hatte Hume die Lösung seiner „skeptischen Zweifel“ in einer „Art prästabilierter Harmonie zwischen dem Lauf der Natur und der Abfolge unserer Ideen“ gesehen‚ die in der intuitiven und gewohnheitsmäßigen Verarbeitung von Erfahrungen bestand. Davon entfernt er sich mit den hier genannten Formen systematischen Denkens und macht einen deutlichen Schritt in Richtung verstandesgelenkter methodischer empirischer Forschung. In der prästabilierten Harmonie mit ihrer Gewohnheit hatte Hume die Fähigkeit verankert‚ brauchbares Wissen über die Welt zu gewinnen. Mit seinen Bemerkungen über den Nutzen des Verstandes und systematischer Prüfungen brachte er darüber hinaus die Idee der methodischen Verbesserung solchen Wissens ins Spiel.
Diesen Weg hat später nicht nur die empirische Wissenschaft praktisch beschritten‚ sondern insbesondere auch der Kritische Rationalismus mit seiner erkenntnistheoretisch begründeten Methodologie‚ der Wahrheit möglichst nahe zu kommen. Doch bis dahin hatte die Erkenntnistheorie noch einen weiten Weg zurücklegen müssen. Zunächst ist zu klären‚ ob nicht Kant in seiner Auseinandersetzung mit Hume eine radikalere Lösung finden konnte‚ nämlich dessen skeptischen Zweifel nicht nur systematisch zu begrenzen‚ sondern wieder ganz zu überwinden.
54 Zu den folgenden knappen biographischen und bibliographischen Anmerkungen s. Gerhard Streminger‚ David Hume: >Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand<‚ (Ferdinand Schöningh) Paderborn‚ München‚ Wien‚ Zürich 1994 (UTB 1995)‚ S. 19 ff.‚ sowie David Hume‚ An Enquiry Concerning Human Understanding. Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand. Englisch/Deutsch‚ (Reclam Universal-Bibliothek) Stuttgart 2016‚ S. 436 ff.. (Im Folgenden alle Zitate aus dieser Quelle im fortlaufenden Text unter EHU und Seitenangabe.)
55 David Hume‚ Traktat über die menschliche Natur‚ (Felix Meiner) Hamburg 1978
56 Unter professionellen Philosophen gilt allerdings der Treatise als das wichtigere Werk. Gerhard Streminger‚ einer der besten Hume-Kenner im deutschsprachigen Raum‚ schreibt: „Heute ist Humes Jugendwerk freilich als das anerkannt‚ was es ist: als ein Meisterwerk und als der‚ neben John Lockes An Essay concerning Human Understanding‚ wohl wichtigste englischsprachige Beitrag zur Philosophie.“ (Gerhard Streminger‚ a. a. O.‚ S. 20.)
57 Gerhard Vollmer unterscheidet in seinem Aufsatz Gott und die Welt. Atheismus‚ Metaphysik‚ Evolution‚ in: Aufklärung und Kritik 3/2010‚ in diesem Sinne zwischen guter und schlechter Metaphysik.
58 Oswald Külpe‚ Immanuel Kant. Darstellung und Würdigung‚ (B. G. Teubner) Leipzig 1907‚ S. 86.
59 Zu den einzelnen Vorstellungen und Begründungen‚ die Hume zu der Beziehung zwischen Gedanken und Ideen einerseits sowie Eindrücken andererseits vorträgt‚ findet man z. B. bei Streminger eine ganze Reihe von kritischen Anmerkungen (Gerhard Streminger‚ a. a. O.‚ S. 66 ff.). Auch ohne darauf im Einzelnen einzugehen‚ mag die knappe Zusammenfassung dessen‚ wie Hume sich die Beziehung zwischen Gedanken und Ideen sowie Eindrücken vorstellt‚ genügen‚ nicht nur‚ um ihren Stellenwert für Humes Erkenntnistheorie einschätzen‚ sondern auch‚ um ihre Plausibilität beurteilen zu können.
60 Nimmt man „Gedanken ohne Inhalt“ als Subjekt und „sind leer“ als Prädikat‚ dann ist dieser Satz nach Kants eigener Definition streng genommen ein analytischer Satz‚ also immer wahr‚ aber ohne wirkliche Information (s. dazu im Einzelnen das Hegel-Kapitel unter 3. [1]). Man muss jedoch mit Kant „ohne Inhalt“ im Sinne von „ohne Wahrnehmungsinhalt“‚ also „ohne realen Bezug zur Welt“ verstehen‚ und „leer“ im Sinne von „sie können uns nichts Substantielles bieten“; dann wird ein synthetischer‚ also aussagekräftiger Satz daraus.
61 Gerhard Streminger‚ a. a. O.‚ S. 92
62 Um von Ideenassoziation sprechen zu können‚ müsste es eigentlich „Ursache und Wirkung“ heißen‚ doch auch im Original steht „cause or effect“.
63 Humes philosophische Schrift ist ganz unterschiedlich beurteilt worden. Argumentationskunst‚ Klarheit des Ausdrucks‚ gelegentlich schlampige Formulierungen‚ leicht verständlich‚ seicht‚ mindestens so schwer wie Hegel - trotz ihrer Widersprüchlichkeit sind das alles Eigenschaften‚ die ein und demselben Werk zugeschrieben worden sind (s. Gerhard Streminger‚ a. a. O.‚ S. 13 f.) und andeuten‚ wie tief man in einen Kommentar einsteigen könnte. Um die Übersicht zu behalten‚ reicht es‚ Hume im Folgenden nur mit dem Ergebnis seiner Überlegungen und den dazu notwendigen Argumenten zu Wort kommen zu lassen.
64 Siehe hierzu z. B. Hans Jörg Sandkühler (Hrsg.)‚ Enzyklopädie Philosophie‚ CD-ROM‚ Artikel Syllogismus.
65 Die Unmöglichkeit des Induktionsschlusses und der erkenntnistheoretische Umgang damit ist ein zentrales Thema des Kritischen Rationalismus‚ wird also im VIII. Kapitel ausführlicher erörtert.
66 Immanuel Kant‚ Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik‚ die als Wissenschaft wird auftreten können‚ 1783‚ (Reclam Universal-Bibliothek) Stuttgart 1989‚ S. 9.
67 Wolfgang Röd‚ Der Weg der Philosophie‚ Bd. II‚ (Verlag C. H. Beck)‚ München 1996‚ S. 94.
68 Isaiah Berlin‚ Hume und die Quellen des deutschen Antirationalismus‚ in: ders.‚ Wider das Geläufige‚ (Europäische Verlagsanstalt) Frankfurt am Main 1982‚ S. 271.
69 Bertrand Russell‚ Philosophie des Abendlandes‚ a. a. O.‚ S. 682.
70 Husserl bezieht sich auf den Treatise und nicht auf die in diesem Kapitel zugrunde gelegte Enquiry. Das ist aber ohne Belang‚ weil wir von Hume selber wissen‚ dass er durch die spätere Veröffentlichung der Enquiry nur einige „Nachlässigkeiten seines früheren Gedankengangs und noch mehr des Ausdrucks“ beseitigen wollte‚ dass es also zu keiner grundlegenden Veränderung seiner erkenntnistheoretischen Ansichten gekommen ist (vgl. o. die Vorbemerkung).
71