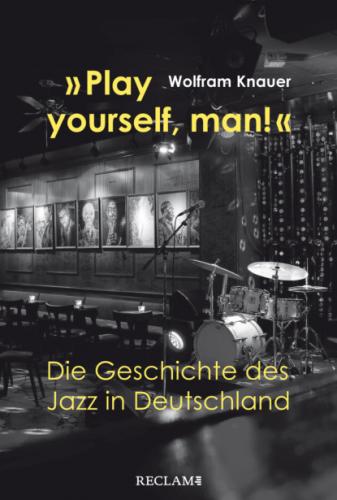Notenausgabe von Ernst Kreneks Oper Jonny spielt auf, 1927
Was für eine Idee! Krenek verleiht hier der Furcht vieler Europäer eine Stimme, die sich neuen Moden, neuer Musik, neuen Tänzen, neuen sozialen und sexuellen Freiheiten ausgesetzt sahen, die die hergebrachte Ordnung umzustürzen drohten. Die Oper erhielt gleichzeitig höchstes Lob und vernichtende Kritiken. Dabei wurde sie – entgegen Kreneks eigenem Verständnis – meist als Jazzoper begriffen, also als eine Oper, deren musikalisches Material auf dem aufbaute, was damals als Jazzmusik verstanden wurde. Die jazzigste Passage ist »Leb wohl, mein Schatz«, auch bekannt als »Jonnys Blues«, das sofort ausgekoppelt und, gesungen vom Bariton Ludwig Hoffmann, auf Platte veröffentlicht wurde. Man hört die jazz-assoziierten Instrumente, Banjo, Saxophon und Schlagzeug, man hört blueshafte Phrasen, man hört eine Art gegenläufige Riffs. Auf der Rückseite der Schellackplatte ist die Schlusshymne zu hören, »Nun ist die Geige mein«, gefolgt von Reminiszenzen an »Jonnys Blues«, die immer wilder und mitreißender werden, bis eine nun von »Jonny« gespielte Geigenkantilene die Aufnahme beschließt.
Gleich nach der Uraufführung gab es überall empörte Reaktionen. Allein die Spielzeit 1927/28 sah 421 Aufführungen in 45 Städten. In München wurde die Aufführung an der Staatsoper »aus ästhetischen Gründen« wieder abgesagt, immer wieder wurden Stinkbomben geworfen. Ebenfalls in München warteten bei der Premiere in einem anderen Theater angeblich sogar einige »hundert irregeleitete Radaubrüder« vor dem Bühnenausgang, »um den verhaßten Schwarzen zu lynchen, wenn er erscheint«. Der deutschnationale und rassistische Protest richtete sich dabei zuallererst gegen eine Oper, in der »ein Neger die Hauptrolle spielt und in der die schwarze Rasse ihren Siegeszug über die Welt beginnt«86. Man ahnt die Einschätzung der Braunhemden, die das Werk als »undeutsch«, als »entartete Kunst« ansahen.
Einzelne Formulierungen aus Ernst Kreneks Jonny spielt auf finden sich übrigens fast wortgleich wieder in einem launigen Essay über »die moderne Tanzkapelle« von 1927, in dem Hermann Schreiber beginnt: »Es sprangen da über den großen Teich einige freche Jazzband-Spieler. Sie rasselten mit Kinderklappern, pfiffen auf Trillerpfeifen und gebärdeten sich, als sei die Hölle losgelassen. Gewittergleich fegten sie durch die Säle des alten Europas, und wo sie hinkamen, da flohen entsetzt die Ländler, die Française, die Quadrille und der Walzer. Es war ein Siegeszug ohnegleichen, der mit einem Schlag alles niederriß, was man bis jetzt im Gesellschaftstanz für schön und gut befand.«87
Ernst Krenek hatte Jazzelemente in seiner Oper kompositorisch anverwandelt, andere Komponisten engagierten tatsächliche Jazzbands für einzelne Szenen, etwa Kurt Weill für Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny, für das er das 65-köpfige Berliner Symphonie-Orchester im Sommer 1930 um eine Jazzband erweiterte.88 Auch bei der Uraufführung der bekanntesten Zusammenarbeit zwischen Kurt Weill und Bertolt Brecht, der Dreigroschenoper, spielte eine Jazzbesetzung mit, die Lewis Ruth Band (mit bürgerlichem Namen Ludwig Rüth) unter Leitung von Theo Mackeben.89 Die Dreigroschenoper hatte am 31. August 1928 ihre Uraufführung im Theater am Schiffbauerdamm, ihr sofortiger Erfolg war sowohl auf die sozialkritischen Texte wie auch auf die Musik zurückzuführen, die sich einerseits bewusst auf die Modewelle des Jazz bezog, diese jedoch auch in sperrigen Melodien und Harmonien konterkarierte. Eine »Antisalonmusik« wurde sie später genannt; Brecht selbst sprach von »Misuk«, von einer Gegenmusik zu allem Opernhaften und Symphonischen.90 Die Weill’schen Kompositionen wurden schnell zu Gassenhauern; aus den gesellschaftlich aufrütteln wollenden und widerborstigen Nummern wurden entweder gefällige »Tanz-Potpourris« oder aber ernste Studien über aktuelle Stilformen, etwa in den Einspielungen durch Otto Klemperer und Mitglieder der Staatsoper Berlin unter dem Obertitel »Kleine Dreigroschenmusik für Blasorchester«91.
Theo Mackeben (geb. 1897) übrigens, der Dirigent der Uraufführung der Dreigroschenoper, hatte sich seit Anfang der 1920er Jahre einen Namen als Pianist und Dirigent gemacht. Ab 1927 nahm er unter eigenem Namen oder als John Morris oder Red Roberts Platten mit wechselnden Besetzungen auf, die immer wieder Jazzsolisten in den Vordergrund treten ließen. »You Were Meant for Me«, eingespielt im Jahr 1929 vom John Morris Jazz Orchester, beginnt mit dem Verse des amerikanischen Schlagers von Nacio Herb Brown und Arthur Freed, dem vier Chorusse folgen, ohne Soli oder Improvisation, nur durch leichte Besetzungsunterschiede voneinander abgehoben. Einzig eine kurze Klavierpassage sticht heraus, ansonsten ist dies Tanzmusik pur, die von nichts ablenkt, aber auch in nichts heraussticht. »Fünf von der Jazzband« aus dem März 1932 hat bereits erheblich mehr Jazzpotential. Der Titel entstammt dem gleichnamigen Film; die Soli von Klarinette, Saxophon und Posaune sind kurz, aber passabel. Im Film selbst wird der Titel recht klischiert dargeboten, die Schauspieler agieren klamaukig und machen allerlei Mätzchen, doch zugleich ist der Song sehr klar und sauber gespielt, und zwar nicht von den Darstellern, die wir sehen, sondern von der Band hinter der Kamera unter der Leitung von Theo Mackeben selbst.92 Mackeben schrieb ab 1930 immer mehr Musik für den deutschen Tonfilm, darunter Schlager wie »Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da« oder »Du hast Glück bei den Frau’n, Bel Ami«.
Kreneks Jonny spielt auf muss im Zusammenhang mit anderen sogenannten »Zeitopern« betrachtet werden, die sich mit der Modernität der 1920er Jahre befassten und oft genug Anspielungen auf aktuelle Technologien, auf Flugzeuge, Züge, Maschinen oder eben auf den Jazz enthielten. Zugleich ist Jonny spielt auf aber auch eine Art kompositorisches Echo auf die ästhetische Diskussion in diesen Jahren, bei der danach gefragt wurde, wohin es denn gehen könne, wenn die bisherigen Kompositionsmethoden ausgereizt seien. Im Unterschied zu den Bühnenstücken von Bertolt Brecht und Kurt Weill, die immer politische Untertöne besaßen, war Kreneks Werk ein Kommentar der ästhetischen und musikalischen Krise der Zeit.
Der Tanz zum großen Crash
Am 24. Oktober 1929 kam es an der New Yorker Börse zu einem Kurssturz ungeahnten Ausmaßes. Mit diesem Schwarzen Donnerstag, dessen Folgen Europa einen Tag später, am Schwarzen Freitag, erreichten, begann die Weltwirtschaftskrise, und mit der Weltwirtschaftskrise gingen die scheinbar so sorglosen Goldenen Zwanziger Jahre zu Ende. Zwischen 1929 und 1933 verfünffachte sich die Zahl der Erwerbslosen, während das Realeinkommen um ein Drittel sank. Anfangs merkte man im Showgeschäft noch wenig von der Rezession, im Gegenteil neigten die Menschen sogar dazu, sich im Angesicht größter Sorge ablenken zu lassen. Die ersten Fabriken schlossen zwar, das hielt aber niemanden davon ab, auszugehen und zu tanzen.
Unter den Ensembles, die auch in diesen Jahren große Erfolge feierten, sind vor allem zwei erwähnenswert, die bis weit in die 1930er Jahre hinein einflussreich waren. Eines davon sind die Comedian Harmonists, ein Gesangsquintett mit Klavierbegleitung, deren Arrangements dicht und schwungvoll klingen, auch wenn die Mischung aus Barbershop-Gesang und Music-Hall-Boygroup nicht viel mit Jazz zu tun hat. Tatsächlich waren die direkten Vorbilder die amerikanischen Revelers. Ab 1928 hatten die Aufnahmen des Ensembles mit deutschen Texten große Erfolge. Die Titel waren meist fest durcharrangiert, und die Comedian Harmonists boten sie mit Virtuosität und einer gehörigen Portion Humor dar. Ihre Konzerte waren ausverkauft, ihre Aufnahmen wurden zu Gassenhauern, die noch Generationen später bekannt sind. »Veronika, der Lenz ist da« oder »Ein kleiner grüner Kaktus« stehen bis heute für die Unterhaltungsmusik jener späten Weimarer Republik. Drei der Mitglieder waren Juden, was dazu führte, dass die Nationalsozialisten 1935 die Auflösung des Ensembles erzwangen.
Die zweite Band, die die späten 1920er, frühen 1930er Jahre entscheidend prägte, sind die Weintraubs Syncopators, die der 1897 geborene Pianist Stefan Weintraub 1924 in Berlin gegründet hatte. Die Kapelle machte lokal von sich reden und wurde 1927 für die Bühnenmusik zu Frank Wedekinds Franziska. Ein modernes Mysterium in fünf Akten mit Tilla Durieux in der Hauptrolle engagiert. Hier war der Komponist Friedrich Hollaender so begeistert von der Band, dass