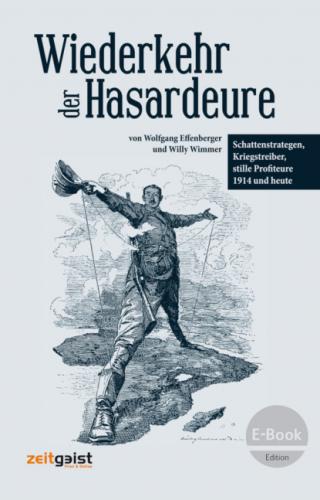Während die Arbeit der Kommission weiterging, machten sich Serbien und Russland daran, die montenegrinische Armee zu reformieren. Sechs Divisonen sollten gebildet und die ständigen Kader erhöht werden. Am 10. Februar 1914 schrieb der russische Geschäftsträger Obnorski aus Cetinje/Montenegro, der serbische Ministerpräsident könne nicht umhin anzuerkennen, wie schwierig die Verwirklichung des Gedankens, einige serbische Unteroffiziere in die montenegrinische Armee einzubinden, sei und dass Pašić »in der Wahl von Mitteln unsere machtvolle Unterstützung in dem dann unvermeidlichen und gewiß vorzeitigen Kampfe Serbiens gegen die österreichische Monarchie auszunutzen gedenkt (!)«207. Obnorski rät seinem Vorgesetzten Sasonow, sowohl Serbien als auch Montenegro vor den übereilten Plänen ihrer Politiker zu bewahren. Auch der talentierte Pašić, ebenso wie viele andere Balkanpolitiker, würde sich durch einen Mangel an weitem Blick infolge eines gewissen Provinzialismus der politischen Gedanken auszeichnen. »Deshalb dürfen die Großmächte, wenn sie den kleinen Reichen Unterstützung und Hilfe erweisen – wie unser Vaterland immer tut, die Führung und Initiative nie aus der Hand lassen.«208
Im Februar 1914 verlegte der russische Generalstab ein sibirisches Korps nach Polen, und der montenegrinische König Nikola lud König Peter von Serbien ein, unverzüglich mit Montenegro eine Vereinbarung über die Vereinigung beider Staaten auf militärischem, finanziellem und diplomatischem Gebiet zu treffen. Abschließend hob er hervor, dass eine derartige Vereinbarung »für das noch nicht befreite Serbentum sehr nützlich sein werde« und auch im Sinne des ewigen Protektors der Slawen, Russlands, sei.209
Ökonomische Dimensionen
Im Frühjahr 1914 war die Weltpolitik nicht nur vergiftet durch die lokalen Problemfelder Serbien, Polen, Elsass-Lothringen und Türkei, sondern auch geprägt vom globalen Kampf um Wirtschaftsräume – und nirgendwo in den Kabinetten war der Wille zum Frieden zu spüren. Die große Masse der Bevölkerung hatte dagegen eine tiefe Sehnsucht nach Frieden. Genauso wie heute hätte es nicht zu Kriegen kommen müssen, wenn es nach den Bürgern gegangen wäre. In einem Geheimtelegramm mit Abschrift nach Paris und Sofia instruierte der russische Außenminister Sasonow den Botschafter in London, das Zustandekommen der bulgarischen Anleihe auf dem Berliner Markt zu verhindern. Bulgarien solle vor dem wirtschaftlichen Zugriff Deutschlands bewahrt werden. In diesem von Russland gewünschten Sinne würde auch der französische Gesandte in Sofia arbeiten.210
Im Mai 1911 erschien in Paris das Büchlein »La Guerre qui vient« (Der kommende Krieg) von Francis Delaisi (1873–1947). Er stellte schon auf der ersten Seite klar, dass es seitens des deutschen Proletariats kein Verlangen gab, sich auf das französische zu stürzen. Auch die einfachen Menschen in England wünschten, in Ruhe auf dem Feld bzw. in ihren Werkstätten zu arbeiten. »Und auch die Franzosen, seien sie Arbeiter oder Bauern, Proletarier oder Bürger, internationale Sozialisten oder radikale Patrioten«, hätten nur den Wunsch nach Frieden.211 »Es müsste also alles gut gehen und wir könnten ganz ruhig sein«, konstatiert Delaisi, »wenn die Völker wirklich die Herren ihrer Geschicke wären.« Doch unglücklicherweise bestimme kein Volk über seine auswärtige Politik, die ausschließlich von einer kleinen Zahl von Diplomaten gemacht würde. »Diese äußerst soignierten Leute rekrutieren sich überall, auch in unserer Republik.« Sie stammten aus dem Brief- oder dem Geldadel, »sind ganz in Händen der Finanz oder der Industrie und arbeiten nur für deren auswärtige Anleihen und Aufträge. Ein Botschafter ist heutzutage mitsamt seinem gestickten Rock nichts anderes mehr als ein Agent der Banken oder der großen Handelshäuser«, daran würde auch der republikanische Aufbau nichts ändern. »Stellt ein Abgeordneter eine Frage über irgendeine auswärtige Angelegenheit, dann antwortet die Regierung immer wieder mit denselben unbestimmten und feierlichen Erklärungen über Bestrebungen zur Erhaltung des Friedens und über das europäische Gleichgewicht.« Dank der nichtssagenden und häufig den Blick verstellenden diplomatischen Sprache würden weder die Völker noch die Parlamente etwas Konkretes wissen. Delaisi fürchtete, dass allein durch ein paar wenige Menschen Völker in die schwersten Konflikte gebracht und in Kriege verwickelt würden und verwies auf die Machenschaften Delcassés in den Jahren 1904/1905. Mit großer Sorge registrierte Delaisi dessen Rückkehr, zwar nur als Marineminister unter Jean Cruppi, doch niemand in Europa solle sich täuschen. Außenminister Cruppi sei am Quai d’Orsay nur ein Strohmann. Delcassé habe nun leichtes Spiel, eine Frankreich an England bindende Militärkonvention abzuschließen. Für Delaisi war es nun an der Zeit, »die Augen zu öffnen und mit kühlem Blick die politische Lage in Europa zu betrachten, um die gefährliche Intrige zu erkennen, in die uns unsere Finanzhäuptlinge verwickeln wollen«212.
Schon 1911 erkannte der Autor des Buches »Der kommende Krieg«, Francis Delaisi, wie Verwicklungen von Politik, Wirtschaft und Banken den Frieden gefährden (© Abb. 13)
In der Tat hatten sich seit Ende des 19. Jahrhunderts die Kriegsmotive und -ziele vollkommen verändert. Ging es Bismarck im deutschen Einigungskrieg von 1870/71 noch um Annexion und Eroberung, machten sich nun Kaufleute, Banker und Industrielle auf der ganzen Welt gegenseitig Absatzmärkte, Eisenbahnaufträge, Anleihen und Minenkonzessionen streitig. Konnte man sich nicht verständigen, griff man zur Ultima ratio der Waffen. Das war erstmalig 1895 zu beobachten, als die Japaner mit den Chinesen um die Ausbeutung von Korea stritten. 1898 gerieten die US-Amerikaner mit den Spaniern wegen Cuba und den Philippinen aneinander, und ein Jahr später überfielen die Engländer die Buren wegen deren Minen in Transvaal. 1900 schickten Europa und die USA Expeditionsarmeen in den chinesischen Boxeraufstand, um die sogenannte »Politik der offenen Tür« durchzusetzen: Für den Handel sollte die Tür offen stehen, und wenn nicht, durfte sie eingetreten werden. So wurden den Chinesen z. B. Eisenbahnen aufgenötigt. Nur um zu entscheiden, wer die Mandschurei ausbeuten dürfe, massakrierten sich 1904/05 über 18 Monate lang gegenseitig Russen und Japaner.
All diese blutigen Kriege brachten den Siegern kaum erwähnenswerten Gebietszuwachs. Die Beute blieb vielen verborgen: Es waren die Absatzmärkte, die Eisenbahnen, die Anleihen und die Zolltarife. Für diese Kriege der »Dividenden« musste die jeweilige Propaganda den Gegner dämonisieren. Diese Aufgabe übernahm – und das in allen Ländern – eine wenn nicht käufliche, doch zumindest kritik- und gedankenlose Presse und erleichterte es damit der Geldoligarchie, ihre Geschäftskriege zu führen. Das galt besonders für die durch ihre Lage und Geschichte bevorzugten Briten, sie erschienen Walter Rathenau »als die Erben der Römer, als die überlebenden Rivalen der Venezianer und Holländer«213.
Dank Stahl, Kohle und Erfindungsgeist nahm die Seemacht England vor allen anderen Nationen eine unvergleichliche industrielle Entwicklung. Begünstigt durch die Insellage, konnten während eines ganzen Jahrhunderts die Webereien von Manchester und die Metallfabriken Birminghams ihre Erzeugnisse über den Erdball verbreiten und immensen Gewinn anhäufen. Nur Frankreich wagte zaghafte Konkurrenz. Dessen Unternehmer schimpften auf das »perfide Albion« – stehender Begriff für die vermeintliche Hinterhältigkeit der englischen Außenpolitik.214 Doch schließlich verzichtete die französische Oligarchie im Jahr 1898 im Zuge des Faschoda-Zwischenfalls – der britische Lord Kitchener ließ im Sudan die Trikolore einholen – auf jeden weiteren Anspruch als Großmacht. England war der unbestrittene Herrscher der Welt. Es hatte am Ende des 18. Jahrhunderts die Trümmer der vorangegangenen Großmächte Holland und Frankreich zielgerichtet eingesammelt. »Jetzt, nach einem Jahrhundert der Herrschaft«, schrieb 1908 auf den asiatischen Schlachtfeldern der hervorragendste strategische Mitarbeiter von Sun Yat-Sen, der US-Amerikaner Homer Lea: »… einer so überlegenen Herrschaft wie die Menschheit sie nie zuvor gekannt hat, sieht sich das Britische Empire einem Kampf um den Besitz von einem Drittel der Welt gegenüber, bedroht nicht nur von einer einzelnen Macht, sondern von vier Mächten. Jede dieser Mächte ist vergleichsweise besser in der Lage, den Engländern die Herrschaft