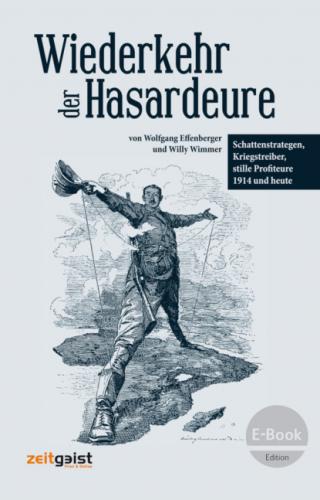Deutschland war indes ohne natürlichen Schutz und von rivalisierenden Völkern umgeben. Noch dazu wurde die wirtschaftliche Entwicklung bei nur mäßigen Bodenschätzen in den nördlichen Landesteilen alle hundert Jahre durch Kriege und Einbrüche regelrecht zertreten. So bildeten die deutschen Lande den Gegensatz zu Englands und Amerikas bevorzugter Lage.
Bis 1870 waren die Länder des deutschen Bundes ausschließlich Agrarstaaten. Da die Böden nicht überall ertragreich waren, wanderten Jahr für Jahr zwischen 100 000 und 200 000 junge Deutsche nach Amerika aus. Nach dem Einigungskrieg suchte Bismarck – und später Kaiser Wilhelm II. – das Deutsche Reich nach englischem Vorbild in einen Industriestaat umzuwandeln. An Rhein und Ruhr entstanden in atemberaubender Schnelligkeit Hochöfen, Stahlwerke und Eisengießereien. Auf den Werften an Nord- und Ostsee wurde eine Handelsflotte auf Kiel gelegt, die Häfen sorgfältig auf ihre kommenden Aufgaben vorbereitet, Eisenbahnnetze ausgebaut und Flüsse kanalisiert. Am Ende des 19. Jahrhunderts erhöhten die Industrien der imperialistischen Länder rücksichtslos die Produktion, um ihre Waren vor dem Konkurrenten an den Mann zu bringen. Das veranlasste Friedrich Engels zu dem noch heute gültigen Kommentar: »Es wird produziert, als wären ein paar tausend Millionen neuer Konsumenten auf dem Monde entdeckt worden.«216
Noch schauten die Briten herablassend auf die deutschen Vettern. Um vor deutschem »Schund« zu warnen, wurde ein Gesetz verabschiedet, nach dem alle Waren deutscher Herkunft die Marke »Made in Germany« tragen mussten. Wie groß muss das Erstaunen und die Wut gewesen sein, als festgestellt wurde, dass dieser Diskreditierungsstempel die deutschen Waren adelte. Obendrein kamen aus allen Teilen der Welt von den zur Überwachung des Handels aufgerufenen englischen Konsulen Berichte über die zunehmende Geschäftstätigkeit deutscher Kaufleute, Unternehmer und Ingenieure. Zugleich verlangsamte sich die Entwicklung des englischen Handels, während der deutsche ungeahnte Höhen erklomm. Umgekehrt dazu verhielt sich das Auswanderungsverhalten. Während die Auswanderungszahlen der Briten und Italiener stiegen, fielen die der Deutschen fast bis auf null. Ist das etwa kein Indiz für ein prosperierendes Deutsches Reich?217
Das Auswanderungsbestreben der Deutschen ging während der Regierungszeit Wilhelms II. stark zurück (© Abb. 14)
Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts behauptete sich die englische Wirtschaft durch globale Führung und Meisterschaft. Großbritannien regierte das Meer und war Marktplatz wie Messe aller Länder: der Rialto der Welt. Doch langsam entwickelte sich ein relativer Rückgang im Vergleich zum beispiellosen Aufschwung der Vereinigten Staaten und Deutschlands.
Zur industriellen Avantgarde gehörte die deutsche Chemieindustrie. Sie hatte im Wettrennen um die Weltmärkte erstaunliche Erfolge erzielt. Die Badischen Anilin- und Sodafabriken Ludwigshafen (BASF) hatten um 1875 nur 885 Mitarbeiter, 25 Jahre später waren es 6700 und 1914 schon 11 000. Weltgeltung und Profite waren ebenso rasch mitgewachsen.
Carl Duisberg, damals Direktor und Vorstandsmitglied der Bayer AG, organisierte zunächst Kartellabsprachen zwischen den sechs großen deutschen Chemiebetrieben, um dann 1904 seinen Plan »zur Sicherung der bedeutsamen Rolle der deutschen Farbenindustrie in der ganzen Welt«218 vorzulegen. Am 8. Oktober 1904 unterzeichneten die Vorstandsvorsitzenden von BASF, Bayer und Agfa im Berliner Kaiserhof die Denkschrift – die erste Interessengemeinschaft (I. G.) war geboren. Aus dieser Keimzelle sollte gut 20 Jahre später I. G. Farben entstehen – der größte Chemiekonzern der Welt. Schon zu Beginn des Ersten Weltkriegs schwebte Duisberg eine künftige Wirtschaftsunion mit Frankreich, den mitteleuropäischen Ländern und Dänemark unter Führung der deutschen Chemieindustrie vor. 1931 ging Duisberg sogar noch weiter und forderte eine Wirtschaftsunion von Bordeaux bis nach Sofia im Interesse der deutschen Chemie.
Dieser rasanten industriellen Entwicklung im Deutschen Reich musste Großbritannien etwas entgegensetzen. Zunächst appellierte man auf wirtschaftlichem Gebiet an das Nationalgefühl, das »National Feeling«. Mit dieser Art ideellen Schutzzolles begannen Staat und Gemeinden bei Ausschreibungen das billigere, ausländische Angebot zugunsten des teuren englischen zu verwerfen. Parallel dazu, so Walther Rathenau, fördere Englands Industrie alle Bestrebungen, »politische Zwischenfälle mit Deutschland hervorzuheben und in so und so vielen Pounds, Shillings und Pence wirtschaftlichen Nationalgefühles umzusetzen«219. Er prognostizierte, dass der ideelle Schutz den Industriellen auf Dauer nicht genügen würde, und befürchtete einen Bruch der großen englischen Tradition des Freihandels sowie eine Rückkehr Englands zum Rettungsring des Schutzzolles.
Vorerst bekämpfte auf der ganzen Welt das englische Kapital das deutsche. Zwischen beiden Ländern entflammte Mitte der 1890er-Jahre ein regelrechter Pressekrieg. Unter der Überschrift »Our True Foreign Policy« ließ die konservative britische Wochenzeitschrift Saturday Review am 24. August 1895 ihre Leser wissen, dass »unser Hauptrivale in Handel und Gewerbe heute nicht Frankreich, sondern Deutschland ist. Im Falle eines Krieges mit Deutschland würde es viel zu gewinnen und nichts zu verlieren geben, während bei einem Krieg mit Frankreich mit schwersten Verlusten zu rechnen wäre.« Weitere antideutsche Artikel gipfelten in der Cato nachempfundenen Forderung »Germania est delenda« – Deutschland ist zu zerstören.220 Das Blatt hatte durchaus Einfluss, zählten doch zu den Mitarbeitern namhafte Persönlichkeiten wie Premier Lord Salisbury, H. G. Wells und Oscar Wilde.221
So wundert es nicht, dass die deutsche Publizistik in England den vermeintlichen Feind ausmachte, der den eigenen Aufstieg nach Kräften behindere. Wie heute ging es um Rohstoffreserven und Wirtschaftsräume. Spielten für Großbritannien vor allem neue Investitionsmöglichkeiten eine Rolle, war es für Deutschland der Siedlungsraum für die schnell wachsende Bevölkerung. Auch zauberten ab dieser Zeit die Kolonialwarenläden Glanz in die Augen der Deutschen – ähnlich wie später die Intershopläden der DDR mit ihren tropischen Früchten.
Von Rudolf Bernauer (1880–1953), österreichisch-ungarischer Bühnenautor und Theaterleiter mit jüdischen Wurzeln (er musste 1935 nach England emigrieren), ist ein aufschlussreicher Stimmungsbericht aus den Jahren vor dem Krieg überliefert. 1905 erlebte er als Soldat, dass sich serbische Bauern zuweilen damit vergnügten, aus dem Hinterhalt auf österreichisch-ungarische Marschkolonnen zu schießen. Bernauer fragte sich damals, wer hinter den Aufrührern stand. Das kleine Serbien? Das hätte es seiner Meinung nach nie gewagt, die Slawen Ungarns offen gegen die Regierung aufzuwiegeln.
Als Bernauer in Berlin auf eine mögliche Kriegsgefahr hinwies, wurde er ausgelacht und belehrt, dass der nächste Krieg zwischen den natürlichen Konkurrenten England und Russland geführt werde, deren Interessen bereits in Asien aufeinander stießen.222 Nach der erfolgreichen Premiere der Operette »Princess Caprice«223 am 11. Mai 1912 im Londoner Shaftesbury Theatre hatte Direktor Courtneidge zu Ehren der beiden Textdichter Bernauer und Welisch sowie des Dirigenten ein Bankett veranstaltet. Nach dem Dessert habe Courtneidge seine Ansprache nach Bernauers Darstellung wie folgt geschlossen: »Die Kunst kenne keine Landesgrenzen, keine Politik und keine internationalen Konflikte. Nach Beendigung des Krieges mit Deutschland werde er als erster wieder nach Berlin kommen, um uns, seine Freunde, zu besuchen und die alten Beziehungen wiederaufzunehmen!«224 Er hat Wort gehalten.
Nachdem sich Bernauer von dem Schock erholt hatte, bat er Courtneidge um eine Erklärung, die ihm bereitwillig gegeben wurde. An den schwierigen Verhältnissen in England sei nur das allzu geschäftige Deutschland schuld. Heute sei es unmöglich, dass die nachgeborenen Söhne in den Kolonien eine Existenz aufbauen und ein eigenes Vermögen schaffen könnten. »Wohin in der Welt man auch blickte, überall seien die besten Stellen von den Deutschen besetzt. Das sei auf Dauer unerträglich.«225 Die Heimreise führte Bernauer und seine Begleiter über Paris, wo sie Entspannung in der neuen und berühmten Revue der »Folies Bergères« finden wollten. Doch diese Revue gab Bernauer den Rest. Als Glanzpunkt des Abends stürmten von Jockeys gerittene Pferde in rasendem Lauf auf einem rollenden Band dahin, ohne sich in Wirklichkeit mehr als einige Meter von der Stelle zu rühren. Die Jockeys, verkleidet als französische Chevaulegers mit Kürass und flatterndem Helmbusch ritten mit gezogenem Säbel eine Kavallerieattacke.