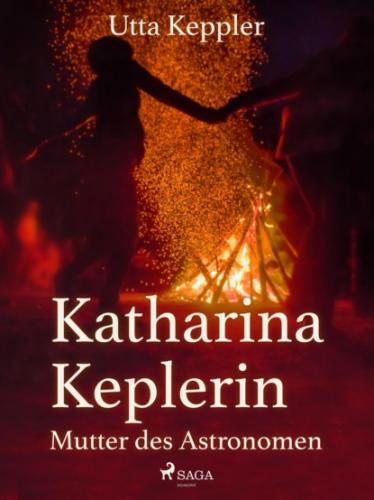Katharina, die Kätter aus Weil der Stadt, hat noch nie ein solches Stück gesehen, und daß ihr Johannes damit zu tun hat, ist ihr unbehaglich. Sie sieht auch keine einzige Frau sonst unter den Zuschauern und wagt lange nicht zu fragen, wer denn der Herr Frischlin sei, der ein solches Spielwerk verfaßt habe? Sie kennt Landsknechtslieder und auch Komödien der Fahrenden – aber dies hier ist ein geistliches Kloster und ein ernsthaftes Spiel.
Sie sitzt gespannt still. Johannes steht hinter einem Verschlag, den man aufgerichtet hat, sie kann ihn nur gerade ahnen, hört aber die Musiker trappeln und brummen, bis sie endlich, unsichtbar versteckt, mit einem Flötenton einsetzen.
Neben ihr lehnt in der ersten Stuhlreihe ein breiter schöngekleideter Herr, sein weicher Bart sieht ein wenig nach dem des Heinrich aus, aber das rötliche Gesicht ist flächiger und die Augen leuchten über einer herrscherlichen Nase unter der gewölbten Stirn; während die Musik fiedelt und bläst – sie zuckt und wippt mit dem Fuß unter dem langen schweren Rock –, schlägt der auch den Takt mit der Hand, und sie guckt zu ihm auf.
Er lächelt und lacht einmal zu ihr hinunter, als ein Horn unerwartet quietscht und der Dirigent – sie sieht seine flatterigen schwarzen Ärmel hie und da neben der Holzwand herauszucken – wütend abklopft und verschwindet. Sie lacht auch, und der prächtige Mann neben ihr fragt, ob sie etwa einen Buben unter den Musikanten hätte.
Nein, bloß mitagieren tät der ihrige, sagt sie halblaut, und sie sei arg neugierig, ob der das könne: Er sei so ein ernster, trockener Kerle, der rechne und zeichne und auch manchmal Verse mache – der ihrige.
»Verse?« fragt ihr Nebenmann, »so? Das hab’ ich auch getan.«
Katharina Kepler wundert sich; sie schaut fragend in das schmunzelnde Gesicht.
»Das Drama ist eins von mir …«, sagt er, »ich bin der Frischlin.«
»Der Professor?« (Johannes hat es ihr gesagt.) »Oh! Da freut’s mich, daß Ihr’s mir erklären könnt – ich versteh’ nicht viel davon.«
Inzwischen sind die Akteure schon da – zwei Bettler humpeln und hinken auf die Bühne, und sie ist froh, als sie merkt, daß Johannes nicht dabei ist …
»Bettelspiele führen sie in England auf …«, sagt sie scheu, denn das hat sie auf der Wanderschaft mit ihrem Mann erfahren. »Eine Versgeschichte!« Halb befremdet klingt es, und Frischlin lacht wieder, diesmal laut.
»Es kommt gleich besser, Frau …«
»Keplerin«, stellt sie sich vor, »der Sohn heißt Johannes.«
Inzwischen haben sie Kulissen verschoben, es knarrt und quietscht hinter dem Bretterzaun, dann fangen die Musikanten wieder an zu spielen.
Es klingt harmonischer als das erstemal, und es scheint auch eine einfachere Weise zu sein, eingängig und wiegend, findet sie.
Aber dann wird die Wand weggetragen, die vorläufig den Vorhang ersetzt. Da steht eine Frau, ein bißchen zu vierschrötig. Katharina muß lachen: Es ist einer von den Buben, den sie in einen Weiberrock gezwängt haben, über den großen Schuhen. Er lamentiert in Frischlins Versen und jammert um seinen Gemahl, den Grafen, der im Krieg sei. –
Katharina wird ernst, düsterer verzieht sie das magere Gesicht, als die Geschichte weitergeht und der Dichter neben ihr um so zufriedener den Takt schlägt bei seinen Blankversen, als könnten so Ausdruck und Eindruck stärker werden: Bettlerszene und würdiges Gerede im Wechsel – und sieh da: Der Graf kommt heim, noch eh die Frau sich zum Wittibsein ganz entschlossen hat – und als Frischlin, warm und begeistert, ihr die breite Hand auf’s Knie drückt und »Hört! Herrlich!« flüstert, hat sie die Augen voll Tränen, weil der Graf da oben auf der Bühne leibhaftig nach Hause kommt und beglückt umhalst wird – und sie hat keine sichere Botschaft vom Heinrich und einen unlesbaren Brief in der Tasche, den ihr der Sohn Johannes deuten soll.
Sie hat’s bisher nicht gewagt, ihn damit zu plagen, wo er doch so voll Geschäftigkeit und Eifer ist; er tritt ja als Bischof aufs Podest und redet getragene Verse, ganz ernst, obwohl er im Stimmbruch ist und manchmal hellauf kieckst – sie merkt es.
Die anderen sitzen gebannt, angetan oder ein bißchen kritisch. Der Dichter neben ihr ist jedenfalls beschwingt und begeistert, da er seine Gedankenarbeit vorgetragen hört, sie bewegt und menschlich lebendig gespielt sieht. Gerührt lobt er die jungen Burschen, und er legt einmal auch den Arm um die Schulter der Keplerin, als der Bischof recht reif und gescheit betont, was er darzutun hat.
Die Spieler sind abgetreten, nach einem pompös aufgemachten Schlußbild; man hat sogar ein paar Büsche und große Blumenstöcke auf die Bretter getragen, Lampen und Fackeln aufgestellt, da es schon dämmrig ist, was der Dichter sehr wirkungsvoll findet und gutheißt, – und dann endlich spielen die Musikanten noch einmal auf, heiter, weil’s überstanden ist und auch, weil es der Komponist so will, der es einem Volkslied nachtönen läßt, tanzartig und empfindsam.
Nach dem Spiel lädt der Abt, obwohl er sich nicht ganz wohl fühlt, den Dichter und seine Magister zu einem Imbiß ein, und auch Katharina, die einzige Frau unter den Zuschauern, läßt er mit ihrem Sohn bitten. Solch ein Gegenüber sehe er gern bei sich, sagt er vergnügt zum jungen Kepler, den er als einen »Besonderen« und »Zukunftsfähigen« gern hat. Die übrigen Spieler, verspricht der Abt, würden an einem besonderen Tag geladen, da nicht alle Platz hätten an seinem Tisch und ihn der große Haufe doch ermüde.
Die Äbtin hat sich wegen der vielerlei Aufsichtspflichten bald entfernt – so ein Spektakel bringe doch manches durcheinander im geordneten Lauf der Schule. Sie ist übrigens eine freundliche Dame, belesen und des Lateinischen kundig, wie man von ihr sagt, aber ihr seltsamer Titel läßt Katharina lächeln.
Viele katholische Klöster sind nach der Reformation zu Seminaren für die jungen evangelischen Pfarrschüler gemacht worden, zu höheren Theologenschulen, deren Lehrpläne strenge Maßstäbe anlegen. Der Herzog will seinem kleinen Land den Ruf erhalten, seine Geistlichen seien allseits geprüfte und gelehrte Leute; in Philosophie und Mathematik, in der Rhetorik geschult, und vor allem den alten Sprachen geschliffen, auch mit der Sternkunde und den alten Schriftstellern vertraut – in der Theologie hart geprüft –, soviel hört Katharina, ohne es ganz zu verstehen.
Wer diese Schule leitet, heißt – noch immer – »Abt«, und da er nach dem Vorbild Luthers heiraten darf, läßt er seine Frau die »Äbtin« nennen.
Katharina wagt sich kaum zu zeigen, da sie ja im Reisehabit sei, und dieses zerdrückt und staubig und kaum für ein Fest gerichtet; aber die Äbtin heißt ihre Jungfer, ein Kleid heraussuchen, das der Keplerin passen könnte, und die findet eins, das der zierlichen Frau, wenn man den Goldgurt enger schnallt und den Halssaum ein bißchen zusammenschnürt, wohl ansteht. Sie wäscht sich, man strählt sie, und sogar die Schuhe werden gewichst.
Johannes bleibt im Bischofskostüm, in dem er agiert hat – bis auf die Mitra, die legt er ab und sieht im lila Rock noch gelber aus als sonst, mit großen dunklen Augen und glattem Haar, und Katharina hat kaum Zeit, ihm die Hand zu streicheln und etwas von einem Brief zu flüstern, den sie bei sich habe.
Auch er kann nichts sagen, schaut nur fragend auf und wartet, bis das Mahl vorbei ist, um sie dann endlich auszuforschen, warum sie gekommen sei.
Aber das zieht sich hin, mit Entenfleisch in der Brühe, mit Klößen und Früchten und Mus, und als man endlich die Gabeln hinlegt und die Messer abwischt – Gabeln, die der Abt durch den Hof aus Italien bezieht –, bleibt man noch beim Wein sitzen.
Dem Scholaren, der irgendeine Regel verletzt hat, ist in den vergangenen Tagen der Weingenuß beim gemeinsamen Essen verboten worden – er denkt schmunzelnd daran, daß der Abt das übersieht oder vergessen hat, und hebt seinen Becher gegen den hohen Herrn, gegen Frischlin und gegen die Mutter, die, rotgeworden, mittut.
Der Herzog, Ludwig von