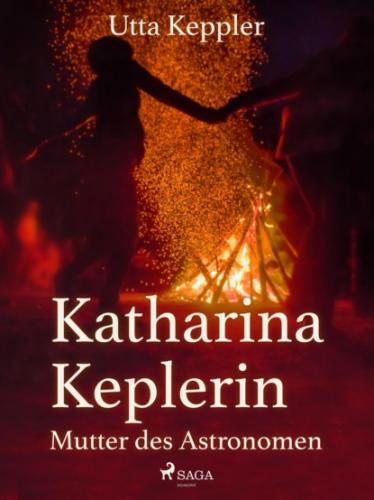Katharina läßt’s den Sohn merken, der ihr bedeutet, er könne doch den großen Mann nicht mahnen, und endlich legt sie ernsthaft den Finger auf die Lippen und sieht den Singenden eindringlich an. Er versteht, so wild es schon in seinem Hirn kreiselt, und hält sich selber scherzweise den Mund zu.
Die Frau Äbtin nutzt die Stille, die sie draußen merkt, und steckt den Kopf zur Tür herein, um ihren Mann zu bitten, er möge sich zur Ruhe begeben.
Und so löst sich die Festgesellschaft auf. Katharina greift nach der Hand des Sohnes und geht – mit einem bittenden Blick auf den Abt – mit dem scheuen Buben hinaus.
Sie stehen dann wieder vor dem dreifachen Brunnen. Es ist dunkel, aber aus der Tür hinter ihnen scheint Licht, jenseits des Ganges, und Johannes stellt sich so, daß er den Brief lesen kann, den sie ihm reicht.
Es ist ein harter Bogen, ein Fetzen eigentlich, und er kann kaum herausbringen, was die krakeligen Buchstaben bedeuten.
Es sei Botschaft gekommen, steht da, von der Grenze nach Hungaria, da die Söldner und Knechte stünden, daß der Henricus Keplerus habe sein Fähnlein wacker geführt … Bis hierher liest Johannes vor, sagt dann, das Schreiben sei von einem Fremden, nicht vom Vater, aber es scheine von ihm zu handeln. Erst danach, als Katharina schon stiller und nicht mehr so gespannt zuhört, liest er stumm zu Ende. Seitdem habe man nichts mehr von ihm erfahren, obschon er wegen seiner mutigen Kraft und Furchtlosigkeit bekannt genug gewesen …
Solche gewundenen Auskünfte sind Johannes ärgerlich, er liest noch einmal für sich, ehe er der Mutter sagt, es sei nichts Neues in dem Schreiben, und sie brauche sich nicht zu ängstigen.
Was er nicht sagt, ist, daß der Zettel einen Anhang hat, auf dem die Unterschrift steht, wo Feldhauptmann und Obrist sich unterzeichneten und den ehrbaren Kriegstod des Kepler anzeigen – so glaube man, da er von der letztgewesenen Schlacht nicht ins Lager heimgekehrt.
Katharina läßt sich nicht lang täuschen, zu gut kennt sie die Mienen ihres Buben und dringt und drängt und bohrt weiter, bis sie die bittere Mutmaßung der Hauptleute erfahren hat. Danach fängt sie an zu weinen, weint leiser und endlich nur noch wie ein Windhauch, aber sie zittert, und der Sohn weiß sich nicht zu helfen. »Jetzt bin ich ganz allein«, versteht er und hört noch mehr: »Du bist doch der Älteste und solltest mir beistehen in der Gaststube und bei der Mannsarbeit – ich weiß schon, Hannes, was das wär für dich, aber sieh doch …«
Er steht mit hängenden Händen vor ihr. Endlich streicht er ihr über den Arm, nimmt ihre Hand und wendet den Kopf, als drüben ein Choral gesungen wird, so als brächte der ihm Hilfe. Er seufzt und versucht zu reden. Aber es wird ihm schwer.
»Das kann nicht sein, die Studien sind zu weit, ich muß vollenden, muß fertig machen, bin gebunden – sieh doch …«
Sie sagt nichts mehr. Johannes fragt, um abzulenken, warum man denn das Schriftstück nicht dem Großvater gezeigt habe, der es doch hätte lesen können?
Sie antwortet, der wäre einer Unpäßlichkeit wegen nicht im Amtshaus erschienen, das habe man ihr sagen lassen, und deshalb sei sie ja auch bei ihm eingekehrt, zur Pflege. Der Bote habe es in der Wohnung abgegeben, und soviel hätte sie schon verstanden, daß es etwas Gewichtiges sein müsse und an sie, die Ehefrau des Heinrich – oder Friedrich –, was unleserlich geschrieben, sei es gerichtet gewesen … Und der Ahnherr sei ja auch schon bald siebzig Jahre alt.
Sie reden noch eine Weile, endlich ist es ruhig um sie her, der Abt wird den Scholaren beim Magister entschuldigen. Sie sprechen vom Vater. Katharina meint zögernd, es sei ihr nicht recht glaubhaft und geheuer, daß ihr Heinrich hätte sterben sollen, ohne sich ihr irgendwie »anzuzeigen«. Sie nennt es mit dem alten geheimen Wort, und Johannes sieht verlegen und traurig zur Seite, weil ihn die Ahnungen und Wachträume der Mutter verstören und bedrücken und er sie ihr am liebsten ausreden möchte. Er sagt freilich nichts.
»Ich hab’ deinen Vater oft vor mir gesehen und ihn gerufen, wenn ich es fest wollte, ich sah sogar, wo er gerad’ war – aber ich hab’s kaum einem erzählt.«
Johannes wird unruhig. »Tut das auch nicht, Frau Mutter, Ihr wißt nicht, wie übel die Leute denken, ich …, ich hab’ Angst um Euch, wenn Ihr so redet.«
»Du brauchst um mich keine Angst zu haben, Hannes«, flüstert sie, »ich lern’ es jeden Tag, wie man sich wehren kann und muß – immer besser lern’ ich’s«, sie zögert, »seit der Vater mich alleingelassen hat.«
So hat sie noch nie gesprochen.
»Ja, Mutter, ich weiß schon, aber …«; er besinnt sich, sagt dann betonter: »Wir sind die Schwachen, so, ohne Vater und ohne Geld, und wer’s schlecht mit uns meint, kann uns verderben, und wär’s bloß mit wüsten Reden.«
»Was können sie uns nachsagen, Kind? Wir sind ehrlich und frei, und kein übler Leumund hängt uns an.« Er sieht auf und schüttelt den Kopf. »Ich hab’ gehört, sie wühlen wieder – verwirrte, halbkranke Gemüter – meinen, die Unholden gingen um, man müsse auf der Hut sein; ach! Sag’ kein Wort, das sie dir verdrehen und verdeuteln können.«
Er beißt sich auf die Fingerknöchel, preßt die Lider zusammen. »Ich darf dir nicht helfen, Mutter, hier ist mein Platz, und – Gott hat mich’s geheißen, daß ich das Studium weiterführen soll.«
Sie seufzt.
»Hüt’ dich, liebe Mutter«, flüstert er gequält, »es treibt mich so um, wenn ich fürchten muß, man hängte dir was an – weißt doch: Die arme Bas! Und so ein Verdacht – ach, Mutter, das könnt’ mich einmal das Amt kosten, so ich’s endlich erreicht hätt’!«
Anderntags muß sie reisen, die Wirtschaft und die Kinder brauchen sie, der Heiner ist jetzt dreizehn, immer noch »stumpig«, wie sie in der Nachbarschaft sagen, und seine Anfälle und »schäumenden Krämpfe« hat er jetzt sogar mehr als früher; Margarethe gedeiht, ein rundes, kräftiges Mädchen.
Katharina dankt dem Abt noch einmal, sie gibt Johannes die Hand und beruhigt ihn – sie wolle ihn nicht drängen zum Heimkommen –, vielleicht, wenn alles vorbei sei und er ein Pfarramt angetreten habe, werde es ihr leichter gemacht, man gewinne auch Ansehen damit, und nicht bloß durch den Großvater. Er lächelt trüb – am nächsten Morgen werde er sie noch einmal sehen, sagt er.
Ein Wagen ist schon bestellt, der sie heimbringen soll. Sommermorgen, die Felder sind blaugrün im Tau, es ist noch kühl, sie denkt an den Sohn zurück, an seine Warnung vor den bösen Gerüchten und dem dummen Klatsch, sie wehrt sich gegen das Unklare – und Heinrich? Ach, der hätte ihr auch nicht viel beigestanden, hat ihr von je das Erhalten und Zusammenhalten aufgebürdet und ist wie ein Bub dem bunten Fahnentuch nachgelaufen; und der Sohn, den sie so gern hat – der läuft seiner Wissenschaft nach, seinen Spekulationen, die sie nie verstehen wird, das weiß sie –, Berechnungen und Glaubenssätzen, griechischen Formen und lateinischen Formeln, was soll’s? Gott spürt sie, den braucht sie nicht zu ergrübeln, so nicht, wie die Gelehrten es tun, und nicht mit der dürren Bangnis etlicher Kirchenmänner, und auch nicht mit Beschwören und Gemurmel, das die Leute von ihr wollen.
Das ist ihr höchstens einmal unterlaufen, wenn sie einem Sterbenden den Trost hat geben wollen, den er verlangt hat – und sie hat dabei gedacht: Herr, Heiland, hilf ihm, und wenn’s nur mit meinem verzweifelten Willen ist …
Johannes, der kluge Rechner, der hat Angst vor dem Hexengerede. Und sie? Seit die Base hat sterben müssen, weiß sie doch, daß das ganze Wesen und Meinen wie ein krankhaftes Geschwür ist, Geschwür im Innersten, das man nicht wuchern lassen darf, um der armen, armen Base willen, um der vielen schreiend gequälten Weiber willen; sie kann’s nicht glauben, daß die alle bös waren; nur dumm waren sie, verscheucht, verängstigt, beredet und übertölpelt … Sie schaut wieder über die Felder, während der Wagen rattert, zieht ihr Tuch enger um sich, der Wind kommt stärker auf – die Fahrt wird noch lang dauern …
Da holt sie ein Reiter ein, sie