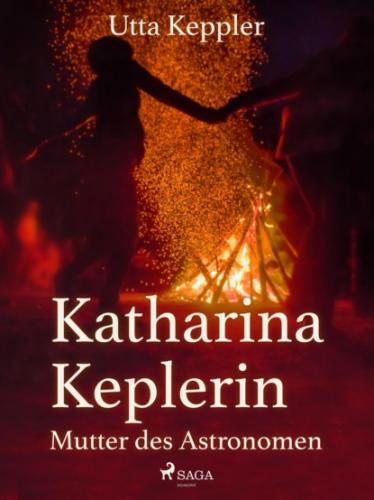Es geht ein paar Wochen so, südwärts am Rhein hinauf, streckenweise fahren ein paar halbverhungerte Weiber mit; ein Kind, verwildert, verlaust, läßt er widerwillig unters Stroh kriechen. Drüben am Himmel brennen die Dörfer.
Sie sind noch nicht weit genug vom Krieg, und wenn ein Trupp Musketiere daherkommt, müssen sie ausweichen und warten.
Heinrich trägt den Flachhut mit den Federn, der ihn als »Fendrich« ausweist, er hat einen Adelsbrief vom Alten vorgezeigt, dem er ihn verdankt; den Gaul hat er verkauft, die Frau kann nicht mehr reiten, ein zweites Pferd hat er auch nicht.
Das Land ist eben und voll Nebel, »der Herbst wächst herein«, sagt Katharina, »er schwillt auf und deckt alles zu«, keine Sonne mehr, kaum Licht, wie sie so fahren. Sie sagt wieder: »Wenn der Heinerle nicht mehr lebte …«, dann leiser: »… oder mein Hannes!«
Er tröstet sie, der sei dürr und zäh und habe lebendige Augen. Die Ahne werde schon achtgeben.
Sie übernachten im Heu bei einem Bauern, der auch das Pferd einstellt. Heinrich hält sie im Arm. Sie drückt das Gesicht gegen den Koller, den er jetzt aufknöpft, damit sie näher ist. »Noch zwei Wochen«, sagt er. Katharina sitzt gekrümmt im Stroh und stöhnt. Sie hat Schmerzen, er fragt, was sei – da sieht er, daß sie blutet. Die Bäuerin nimmt sie auf, zögernd, die fremden Weiber mit dem Kind fahren weiter, Heinrich sitzt verzweifelt neben ihr; das Würmlein, das sie von sich gleiten sieht, ist tot.
Dann, bald danach, müssen sie weiter. Es ist in den Orten seltsam still. Kein Truppenzug trampelt und trappelt über die Straßen, hier brennt kein Haus, niemand schreit Befehle, kein Bauer ist auf dem Acker, im Dorf sei – die Pest, heißt es. Das ist eine andere Angst als seither, da sie es trommeln hörten, schreien und schießen, eine lautlose Angst, schleichend und schwarz, sie sind mitten in einem Übergreifenden, Übermächtigen; es gibt nur Flucht, und wer weiß, was mitflieht? Im Wams, im Mantel, im Schuh, im Staub?
Überall, in und außer den Fliehenden, kann es nisten und knospen und wuchern …
Katharina fiebert. Sie nimmt nichts wahr, es ist ihr nichts »gewärtig« – das ist das Wort, das Heinrich immer wieder flüstert in seinem verschollenen Schwäbisch.
Einmal am Abend, nach einem kalten Tag, zieht der Bauer die Plane ab, es ist sternklar – sternklar und kalt –, er will das Stroh aufschütten, die Plane auf einen langen Zaun zum Trocknen aushängen, und plötzlich faucht es bös aus dem Horizont; Dunstberge brauen sich ineinander, die Sterne verschwimmen wie in trüben Wellen, es wird dunkler, und das Klare löscht aus. Es donnert. Und ist doch Herbst und ein Sternenhimmel war da – es donnert! Katharina sitzt im Stroh, das graue Tuch um den Kopf, der Mann daneben. Seit dem verpesteten Dorf haben sie keine Mitfahrer mehr aufgenommen.
Es kracht, berstend knallen Wolkenzüge ineinander, wie Meerwogen und Weltungeheuer ringt und schlingt sich das Gestaltlose über ihren Köpfen, der Wagen steht, die Gäule steigen und wiehern. Heinrich springt ab und faßt einen Zügel, der Bauer den zweiten. Es klatscht jetzt wild um sie her, spritzt und strömt, die Pferde suchen den Waldrand, wo es matter rieselt; Katharina ist naß und friert.
Sie fahren weiter, schlafen erschöpft irgendwo im Heu, fahren noch eine Woche: Im knackenden bläulichen Frost liegt Weil der Stadt, ein Häuflein Dächer um den Kirchturm geduckt, Nest und Wärme auch jetzt, wo sie geschlagen heimkommen, sorgenvoll, ohne Nachricht, halbkrank und – der Soldat ohne Beute.
Heinrich schickt einen Buben voraus, den er am Weg findet. Da steht die Ahne unter dem Tor an der Staffel, die Buben stehen da, Heiner und Johannes, und die Frauen – Johannes ganz mager, hohläugig, blaß, das Haar strähnig in der hohen schmalen Stirn. Er verbirgt eine Hand hinter dem Rücken.
Der kleinere schreit jubelnd auf: »Hannes, Ahne! Gukket! D’Mueder! D’r Vadder! Älle boide!«
Johannes schaut nur mit den dunklen Augen und sagt nichts. Er sieht die abgerissene erschöpfte Frau, den verwilderten Landsknecht mit der bunten Uniform, fremd und großspurig. Es riecht nach Bier aus dem blonden Bart, den er an die Stirn des Buben drückt.
Er sei »Fendrich« geworden, sagt er gleich, da er den gierigen Blick der alten Frau merkt, der nach dem Beutesack zielt. Er tritt in die Stube, verlangt zu trinken und schiebt der Frau den Becher hin, die gebeugt, schmal, zitternd das dunkle krause Haar aus der Stirn schiebt.
»Hannesle«, sagt sie und zieht den Buben zu sich heran; Heiner drängt sich davor, drückt den Größeren weg und bohrt seinen dicken blonden Kopf in den Schoß der Mutter.
Die Ahne hat einen Zuber gerichtet und verlangt, die Buben sollten in der Küche gewaschen werden, solang Heinrich, der Landsknecht, mit dem Bauern und den Pferden zu tun hat.
Während Katharina ihre zwei Kinder abreibt, stockt sie auf einmal. »Hannesle, was ist mit deiner Hand da?«
Es sei nichts weiter, brummelt der Fünfjährige, die Hand sei so seit den Pocken und die andere ein bißle besser, aber weh tue sie auch, nicht arg, ein bißle … Katharina nimmt die hager-gekrümmte kleine Hand in ihre und streichelt sie; sie merkt auch, daß die Augen des Kindes rote Lider haben, geschwollene Ränder, und daß er blinzelt und das Badewasser nicht verträgt, wenn’s hineinspritzt. »Die Pocken?« fragt sie, »ich hab’s gehört! Wie war denn das?«
Heiner mischt sich krähend in ihre Rede, er sei auch krank gewesen, ärger als der Hannes, und er habe manchmal das Schäumen und Krümmen, das sei ganz »wehlich«.
Katharina stöhnt. Was mag das werden mit den Kindern? Sie hebt den Kleinen vorsichtig aus dem Zuber, damit er nicht vom Wasser den Krampf kriegen soll, und trocknet ihn mit dem Leinentuch ab.
Johannes kann das selber. Mit dem dürren bräunlichen Körperchen, an dem sie die Rippen sieht, steht er vor dem Herdfeuer und reibt sich tapfer ab – sie merkt, wie’s ihn anstrengt, wie müde er ist, wie geschwächt. Es war nicht recht, daß ich mit dem Heinrich gezogen bin, ich hätte bei den Kindern bleiben sollen, und auch das Dritte wär’ vielleicht jetzt in der Wiege, wenn ich nicht da herumgezogen wär’ … Aber er hat’s wollen und wär ohne mich gar nicht mehr heimgekommen, denkt sie.
Sie haben sich in Leonberg angekauft, ein Wirtshaus erworben, schwer gearbeitet. Katharina hat gemeint, es bleibe so, während weit draußen, weiter als sie denken will, die Knechte aufeinanderschlagen, die Waibel und Fendriche und Pikeure und was weiß man noch – während die fetten Markedenterinnen kreischen und lachen und sich in die Ecken drücken lassen und schreien … »Nichts für uns, Heinrich, bleib da, bei uns, bei mir …«
Vier Jahre später gebiert sie den kleinen Sebald, nach dem Großvater genannt, und zwei Jahre danach Friedrich, der klein stirbt.
Johannes ist in der Schule, der Lehrer bestellt den Vater zu sich, es sei etwas Besonderes mit dem Kerle, der sei heller als andere, habe eigene Ideen, sei schon jetzt ein Gelehrter, müsse geistlich werden …
»Geistlich?« brummt Heinrich; es fällt ihm ein, daß das Kind katholisch getauft und lutherisch erzogen ist – »geistlich?« Der solle das Wirtshaus erben, Bier holen und Holz tragen und Pferde füttern. Freilich, zu schwerer Arbeit tauge er ohnehin nicht, sei zart, schmächtig, schlage der Mutter nach; freilich, manchmal schon blitzgescheit, möcht’ sein, er brächt’s einmal zum Officierer, wie sein Vater, möcht’ sein, zu so einem Schreiber, neben dem Feldhauptmann, möcht’ sein, zu so einem Basteibauer und Pionier, möcht’ sein.
Er träumt, ist schon in Gedanken wieder im Feldlager, er verschwindet in einer grauen Nacht …
Katharina wartet wieder, sie wird gezankt und geschunden. »Wenn du den Mann recht hieltest, wär’ er schon dageblieben …«
Abends weint sie oft. Es ist, als wollten ihr die Augen ausrinnen, sie sitzt und starrt durch den Schleier, den irisierenden, den Nebel der Tränen.
Es ist ein später Sommer diesmal,