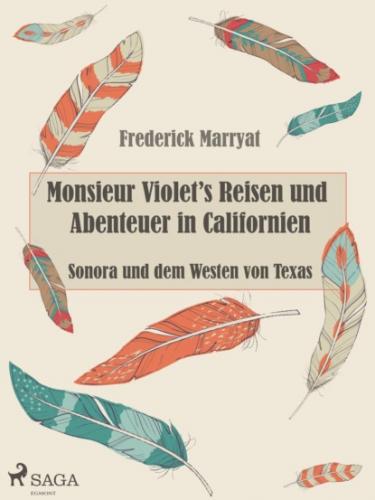Die zwei Leitern wurden je an einem der Thürme angelegt und auf jeder stieg ein Indianer heran. Anfangs warfen sie spähende Blicke durch die Oeffnungen zu beiden Seiten der Thüre, aber wir verbargen uns. Dann bildeten sämmtliche Umbiquas mit ihren Bogen und Speeren einen Halbkreis um die Leitern und bewachten die Schiessscharten. Auf den Befehl des Häuptlings sielen die ersten Hiebe, und die Indianer auf den Leitern begannen mit ihren Tomahawks gegen beide Thüren loszuschlagen. Während übrigens der Umbiqua an der östlichen Thüre den dritten Streich führte, wankte er und fiel die Leiter hinunter. In demselben Augenblicke verkündigte ein Schrei von dem andern Thurme her, dass wir dort den nämlichen Erfolg erzielt hatten.
Die Umbiquas zogen sich Hals über Kopf mit ihren Todten zurück und stiessen ein wüthendes Gezeter aus, das drei von unseren Knaben, dem erhaltenen Befehle gemäss, mit einem schrillen, trotzenden Kriegsruf erwiederten. Die Umbiquas waren hierüber ganz ausser sich, benahmen sich aber fortan klüger. Die Pfeile, durch welche ihre Kameraden getödtet worden, waren zwar Kinderpfeile, indess konnte es doch keinem Zweifel unterliegen, dass sie von Kriegern abgeschossen worden waren. Sie zogen sich hinter einen vorspringenden Felsen an dem Ufer des Flusses, nur dreissig Schritte von uns entfernt, zurück, um sich gegen unsere Geschosse zu decken. Dort bildeten sie einen Kriegsrath und harrten ihrer Leute und Kähne, welche eigentlich schon längst hätten zurückkommen sollen. In diesem Augenblicke zerstreute sich der Nebel, der über dem Flusse geschwebt hatte, und wir konnten das andere Ufer sehen, wo sich uns ein Anblick zeigte, der unsere Aufmerksamkeit fesselte. Auch dort ging ein Zerstörungsdrama vor sich, obgleich in einem kleineren Massstabe.
Uns gerade gegenüber befand sich ein Kanoe, dasselbe, auf welchem Tags zuvor unsere zwei Indianer ihren Ausflug angetreten hatten. Die zwei Umbiquas, welche die gestohlenen Pferde hüteten, waren nur einige Schritte davon entfernt, und da sie es augenscheinlich erst kurz zuvor entdeckt hatten, wussten sie noch nicht, welche Schritte sie einschlagen sollten. Sie hatten mit nicht geringer Verwirrung das Kriegsgeschrei und das Gezeter ihrer eigenen Leute gehört; sobald aber der Nebel ganz entschwunden war, bemerkten sie ihren Haufen hinter dem Schutze des Felsen und schickten sich, wahrscheinlich auf gegebene Signale, zu einer Kreuzung des Flusses an. Wie sie eben den Kahn losbinden wollten, blitzte es auf, und zweimal folgte ein lauter Knall; die Indianer fielen nieder — sie waren todt. Unsere beiden Kundschafter, welche sich im Gebüsch versteckt hatten, kamen jetzt zum Vorschein und begannen in aller Ruhe die Scalpe zu nehmen, ohne den Pfeilhagel zu achten, den die zeternden Umbiquas gegen sie entsandten. Dies war jedoch nicht Alles; die Feinde hatten sich in ihrer Wuth und Hast hinter dem Schirme des Felsen hervorgemacht und boten nun ein schönes Ziel; sobald daher der Häuptling zurückblickte, um zu sehen, ob auch von Seite des Bootshauses her eine Bewegung zu fürchten sey, fielen weitere vier seiner Leute unter unserem Feuer.
Das fürchterliche Geschrei, welches nun folgte, vermag ich nicht zu beschreiben, obgleich mir alle Einzelnheiten dieses meines ersten Kampfes noch frisch im Gedächtniss sind. Die Umbiquas nahmen ihre Todten auf und wandten sich gegen Osten in die Richtung des Gebirgs, wo sie allein noch dem Untergang zu entkommen hofften. Ihre Zahl hatte sich jetzt bis auf zehn gemindert, und in ihrem Aeusseren sprach sich Trauer und Niedergeschlagenheit aus. Sie fühlten, dass es ihnen beschieden war, nie wieder in ihre Heimath zurückzukehren.
Wir vernahmen von unsern Kundschaftern, dass die sechs Krieger des Postens von der Ansiedelung zurückgekommen wären und irgendwo im Hinterhalte lägen; dies wirkte entscheidend auf uns. Wir stiegen die Leitern hinab, welche die Indianer zurückgelassen hatten, und schlugen den Prairiepfad ein, um dem Feinde nach allen Seiten den Rückzug abzuschneiden.
Ich will mich beeilen, diese Gemetzelscene zu Ende zu bringen. Die Umbiquas trafen auf den Hinterhalt, aus welchem weitere vier von ihren Leuten erlegt wurden; der Rest zerstreute sich in der Prairie, wo sie vergeblich einen augenblicklichen Zufluchtsort in den Klüften zu finden bemüht waren. Vor Mittag hatten wir Alle getödtet, einen Einzigen ausgenommen, der sich durch Schwimmen über den Fluss rettete. Er langte jedoch nie wieder in seiner Heimath an, denn lange Zeit nachher erkärten die Umbiquas, dass von jener verhängnissvollen Pferdediebstahls-Expedition nicht ein Einziger zurückgekehrt sey.
So endete mein erster Kampf, ohne dass ich selbst auch nur einen Drücker berührt hätte. Oftmals nahm ich ein sicheres Ziel; dann aber begann mein Herz zu klopfen und mein Finger erlahmte, wenn ich dachte, dass meine Kugel einem Menschenleben gelte. Dies hinderte jedoch nicht, dass ich höchlich belobt wurde; und fortan war Owato Wanisha ein Krieger.
Am nächsten Tag verliess ich mit meinen Leuten — ich meine damit die sieben, die mich von Monterey her begleitet hatten — das Bootshaus, und da wir Alle gut beritten waren, so erreichten wir in kurzer Zeit die Ansiedelung, die ich vor mehr als drei Monaten verlassen hatte.
Ich fand die Verhältnisse günstiger, als ich gefürchtet hatte, denn mein Vater schien sich von dem erlittenen Schlage rasch wieder zu erholen, und unser Stamm hatte auf einem stürmischen Einfall in das südliche Gebiet der Krähen den Letzteren eine schwere Züchtigung angedeihen lassen. Unsere Leute kehrten mit hundertundfünfzig Scalpen, vierhundert Pferden und sämmtlichen Vorräthen an Decken und Tabak zurück, welche die Krähen kurz zuvor gegen ihr Pelzwerk von den Yankee’s eingetauscht hatten. Unsere feindseligen Nachbarn blieben für lange Zeit zaghaft und entmuthigt — ja, sie wagten es in demselben Jahre kaum, ihre eigenen Jagdgründe zu besuchen. Mit dem Tode des Fürsten Seravalle verhielt sich’s, wie ich aus dem Munde solcher vernahm, die dabei zugegen waren, folgendermassen —
Ein Jahr nach unserer Ankunft aus Europa hatte der Fürst Gelegenheit, durch eine Gesellschaft heimkehrender Händler Briefe nach St. Louis am Missouri zu schicken. Mehr als drei Jahre waren verflosseu, ohne dass er eine Antwort erhielt; aber ein paar Tage nach dem Antritte meiner Montereyer Reise vernahm der Fürst von einer Shoshonenpartie, die von Fort Hall zurückkehrte, dass daselbst eine grosse Karavane erwartet werde. Er beschloss daher, sich selbst nach dem Orte zu begeben, um unterschiedliche Metallwaaren, deren wir bedurften, einzukaufen und weitere Weisungen nach St. Louis ergehen zu lassen.
Dort angelangt, fand er zu seiner grossen Ueberraschung nicht nur Briefe für sich mit unterschiedlichen Güterballen, sondern auch einen französischen Gelehrten, der von einer wissenschaftlichen Gesellschaft noch Californien geschickt worden war. Der Letztere war durch den Bischof und dem Präsidenten des College zu St. Louis an uns empfohlen; er hatte auch fünf französische Jäger als Wegweiser bei sich, die viele Jahre ihres Lebens in Streifzügen, von den Rocky Monetains an bis zu den südlichen Ufern von Untercalifornien, verbracht hatte.
Der Fürst verliess seine Shoshonen bei dem Fort und trug ihnen auf, die Waaren bei einer passenden Gelegenheit nachzubringen, während er in Begleitung seiner neuen Gäste den Rückweg nach unserer Ansiedelung antrat. Am zweiten Tage ihrer Reise trafen sie auf einen starken Kriegshaufen der Krähen, ohne jedoch etwas zu fürchten, da die Shoshonen zu jener Zeit mit allen ihren Nachbarn im Frieden lebten. Die treulosen Krähen jedoch, welche eben so wenig als der Fürst wussten, dass sich eine Shoshonen-Jagdpartie in unmittelbarer Nähe befand, wollten eine so schöne Gelegenheit, ohne viele Gefahr reiche Beute zu erwerben, nicht aus der Hand geben. Sie liessen die Weissen ihres Weges ziehen, folgten ihnen aber in einiger Entfernung nach und überraschten sie Abends in ihrem Lager so plötzlich, dass an ein Waffenergreifen nicht zu denken war.
Die Gefangenen wurden mit ihren Pferden und ihrem Gepäcke nach der Stelle geführt, wo ihre Ueberwinder Lager gemacht hatten und nun alsbald Berathung abhielten. Der Fürst machte dem Häuptlinge bittere Vorwürfe über seine Verrätherei, denn er wusste nicht, dass die Krähen die grössten Schufte zwischen den Gebirgen sind. Die Händler und sämmtliche Indianerstämme schildern sie als „Diebe, die nicht wissen, was es heisst, ein Versprechen zu halten, oder eine ehrenhafte