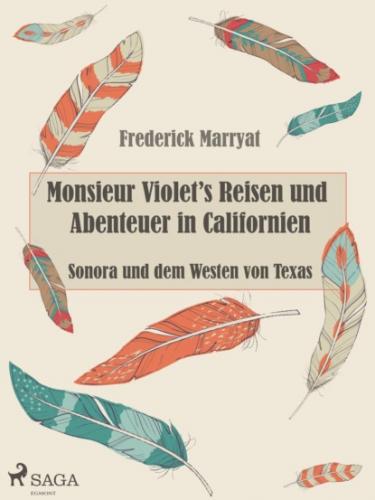Der Leser wird seiner Zeit finden, dass wir manche waghalsige That ausführten und viele vergnügte Tage mit einander verbrachten. Dies geschah sowohl in den nördlichen Städten von Mexiko, als in den westlichen Prairieen von Texas, wo wir mit den Comanches jagten und gelegentlich einige schuftige Texianer entlarvten, die in den entfernten Ansiedelungen unter der Maske der Indianer an ihren eigenen Landsleuten Raub und Mord zu begehen pflegten.
Neuntes Kapitel.
Die Bemerkungen, die ich über die Shoshonen zu machen gedenke, lassen sich eben so gut auch auf die Comanchen, Apachen und Arrapahoes anwenden, da sie nur Unterabtheilungen und Sprösslinge des ursprünglichen Stammes sind. Die Wakoes, die von andern Reisenden noch nicht erwähnt, ja noch nicht einmal gesehen wurden, werde ich nachher beschreiben.
Es ist hier wohl der Ort, anzudeuten, dass die Shoshonen, obgleich sie mit den Comanchen und Apachen stets im Frieden leben, doch seit geraumer Zeit gegen ihre andern Abkömmlinge, die Arrapahoes, desgleichen auch gegen sämmtliche Dahcotah- und Algonquins-Stämme, die Krähen, die Kickarees, die Schwarzfüsse, die durchbohrten Nasen und andere, Krieg führten.
Was nun erstlich die Religion der Schlangenindianer betrifft, so wirft diese höchst interessante Frage vielleicht mehr Licht auf ihren Ursprung, als aus ihren Ueberlieferungen, Sitten und Gebräuchen erholt werden kann. Soweit ich die Indianer kenne, glaube ich, dass sie vielleicht nicht so religiös, jedenfalls aber weit gewissenhafter sind, als die meisten Christen. Sie glauben Alle an einen einzigen Gott, den Manitou, den sie als den Urheber alles Guten verehren; sie sind jedoch der Ansicht, die menschliche Natur sey zu niedrig, um mit dem „Herrn über Alles“ zu verkehren, weshalb sie in der Regel die Elemente und sogar gewisse Thiere zu ihren Vermittlern wählen, etwa wie dies bei den Katholiken ihren Heiligen gegenüber der Fall ist.
Der grosse Manitou wird von allen wilden Stämmen Nordamerika’s gleichförmig verehrt, und nur der vermittelnde Geist wechselt, obgleich Letzteres nach der Wahl des Einzelnen geschieht und keine nationale Grundzüge dabei stattfinden. Die Kinder lehrt man den „Kishe Manito“ (den Allmächtigen) kennen, weiter nicht. Erst wenn der Knabe in das Jünglingsalter übergeht, wählt er sich eine eigene Gottheit, eine Art Penaten, den er in seinen Träumen kennen lernt. Wenn ein junger Mensch seine Absicht kund gibt, den Geist aufzusuchen, so tragen ihm seine Eltern auf, drei Tage zu fasten; dann nehmen sie ihm Bogen und Pfeile weg und schicken ihn weit hinaus in die Wälder, in’s Gebirge oder in die Prairieen, damit er daselbst die Heimsuchung erwarte.
Ein leerer Magen und Unthätigkeit in der einsamen Wildniss sind gewiss geeignet, wache Träume hervorzurufen. Der junge Mensch denkt an Wasser, Büffel oder Fisch, wenn er hungrig und durstig ist, an Feuer und Sonnenschein aber, wenn er friert. Bisweilen trifft er mit einem Gewürm zusammen, und seine Einbildungskraft verarbeitet derartige natürliche Ursachen oder Erscheinungen so lange, bis sie ganz davon erfüllt ist.
In dieser Weise werden Feuer, Wasser, Sonne, Mond, ein Stern, ein Büffel oder eine Schlange, Gegenstände seiner Gedanken, und natürlich träumt er auch von dem, über was er zuvor gebrütet hat.
Er kehrt dann nach Hause zurück, gräbt auf einen Stein, ein Stück Holz oder auf eine Haut die Gestalt des „Geistes,“ den sein Traum gewählt hat, trägt ihn beständig auf dem Leibe und redet ihn an als einen Fürsprecher, durch den seine Gelübde gehen müssen, ehe sie den furchtbaren Herrn aller Dinge erreichen können.
Einige unter den Indianern erhalten durch ihre Tugenden und ihre regelwässige Lebensweise das Privilegium, sich unmittelbar an den Schöpfer zu wenden, und werden dann in den Bund eingeführt, an dessen Spitze die Ceremonienmeister und die Vorsteher der geheiligten Hütten stehen, welche Novizen aufnehmen und Würden ertheilen können. Ihr Ritus ist geheim, und nur die Mitglieder können Zugang finden. Diese Priester sind, wie vordem die der Isis und Osiris, sehr gelehrt und besitzen erstaunliche Kenntnisse von der Naturgeschichte; desgleichen verstehen sie sich gut auf Astronomie und Botanik, bewahren die Ueberlieferungen und grossen Ereignisse der Stämme auf und bedienen sich gewisser Hieroglyphen, die sie in die geheiligten Hütten malen — eine Zeichenschrift, welche ausser den Angehörigen ihrer Kaste Niemand zu entziffern vermag. Die Wenigen, welche auf ihren Wanderungen von einer Schlange „geträumt“ und sie zu ihrem „Geiste“ gemacht haben, werden unabänderlich „Aerzte“. Die Indianer fürchten dieses Gewürm und bringen es mit dem bösen Geiste in Verbindung, obgleich es in den westlichen Thälern, mit Ausnahme der Gebirge an dem Columbia-Flusse, wo man auf eine Menge Klapperschlangen trifft, keine giftigen Arten gibt. Als „Kishe Manito“ (der gute Gott), in der Gestalt eines Büffels auf die Erde kam, um die Leiden der rothen Menschen zu erleichtern, wurde er von dem bösen Geiste, „Kinebec“ (Schlange) bekämpft. Dieser Theil ihres Glaubensbekenntnisses ist fast ausschliesslich im Stande, den Braminenursprung zu beweisen.
Der „Arzt“ flösst den Indianern Ehrfurcht und Schrecken ein; er ist zwar geachtet, hat aber weder Freunde, noch Weiber oder Kinder. Er verkehrt mit dem bösen Geiste, ist der Mann der dunkeln Thaten, holt seine Kenntnisse von der Erde und aus den Felsklüften, weiss Gifte zu mischen, und ist der einzige, der den „Anim Teki“ (Donner), nicht fürchtet. Mit seinen Zauberformeln kann er Krankheiten heilen, aber auch tödten. Sein Blick ist der Blick der Schlange; er macht das Gras welken, bannt Vögel und Thiere, verwirrt das Gehirn des Menschen und schleudert Furcht und Düster in dessen Herz.
Die Weiber der Shoshonen, der Apachen und Arrapahoes, wie überhaupt aller, die der Shoshonenrace angehören, sind in Betreff ihres Körperbaus den Squaws der östlichen Indianer weit überlegen. Ich kann sie nicht besser schildern, als wenn ich sage, dass sie mit den Araberweibern die grösste Aehnlichkeit haben. Von Person und in ihrem Hauswesen sind sie sehr reinlich, und da alle ihre Stämme sowohl männliche als weibliche Sklaven haben, so wird der Wuchs eines Shoshonenweibes nicht durch schwere Arbeit verkümmert, wie dies bei den Squaws der östlichen Stämme der Fall ist. Gegen ihre Gatten sind sie sehr treu, und ich glaube zuversichtlich, dass jeder Angriff auf ihre Keuschheit vergeblich seyn würde. Sie reiten so rüstig als die Männer und sind in dem Gebrauch der Bogen und Pfeile gut erfahren. Ich war einmal Zeuge, wie ein sehr schönes, zehnjähriges Shoshonen-Mädchen, die Tochter eines Häuptlings, während ihr Pferd in vollem Galopp einherjagte, mit ihrem Geschosse im Laufe von ein paar Minuten neun wilde Truthühner tödtete, auf welche sie Jagd machte.
Ihr Anzug ist eben so geschmackvoll, als züchtig. Er besteht aus einem weiten Hemde von weicher Hirschhaut, mit knapp anliegenden Aermeln, das fast immer blau ader roth gefärbt ist; darüber befindet sich vom Gürtel an ein anderes Gewand, das vier oder sechs Zoll über das Knie hinunterfällt und aus Schwanenflaum, Seide oder Wolle gefertigt ist. Sie tragen Beinkleider von dem nämlichen Materiale, aus welchem das Hemd besteht, und bedecken ihre zierlichen, kleinen Füsse mit schön gearbeiteten Moccasfins. Ausserdem tragen sie noch eine Schärpe von reichem Gewebe und lassen ihre weichen, langen Rabenhaare, die sie gewöhnlich mit Blumen, bisweilen aber auch mit sehr werthvollen Juwelen zieren, in üppiger Fülle über die Schultern niederwallen. Ihre Hand- und Fussgelenke sind von Spangen umgeben, und wenn man einem dieser jungen und anmuthigen Geschöpfe begegnet, wie es mit leuchtenden Augen und aufgeregtem Gesichte der Jagd obliegt, so wird man unwillkürlich an die Schilderungen erinnert, die uns Ovid von den Nymphen der Diana gibt10).
Obgleich die Weiber an den tieferen Mysterien der Religion keinen Theil nehmen, so wird es doch einigen gestattet, sich der Gottheit zu weihen und ein Keuschheitsgelübde abzulegen, wie die Vestalinnen des Heidenthums oder die Nonnen in den katholischen Klöstern. Sie kleiden sich wie die Männer von Kopf bis zu Fuss in Leder und malen ein Bild der Sonne auf ihre Brust. Diese Weiber sind Kriegerinnen, ziehen aber nie in’s Feld, sondern bleiben immer zurück, um die Dörfer zu beschützen. Sie leben einsam und sind gefürchtet, werden aber nicht geliebt; denn der Indianer hasst Alles, was sich eine ungebührliche Gewalt anmasst, die von der Natur angewiesenen Schranken überschreitet