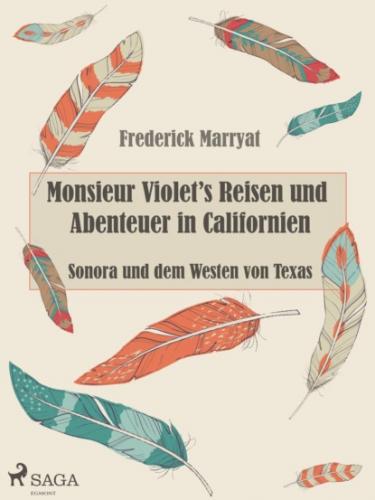Ich tanzte, sang und machte den Hof. Mein alter Reisegefährte, der Missionär, machte mir zwar Vorstellungen, aber die Mädchen lachten über ihn, und ich setzte ihm klärlich aus einander, dass er Unrecht habe. Wenn meine englischen Leser nur wüssten, welch’ ein süsses, allerliebstes kleines Ding ein Mädchen in Monterey ist, so würden Alle ihre Bündel schnüren, nach Californien gehen und dort heirathen. Und doch wäre es Schade, denn mit ihren falschen Begriffen von Camfort, mit ihrer Vorliebe für Kohlenfeuer und ungare Beefsteaks, zugleich mit ihren finsteren Ansichten von Schicklichkeit, würden sie den Ort bald verderben und ihn so steif und düster machen, als nur ein sektirerisches Dorf in den vereinigten Staaten seyn kann, das neben seinen neun Banken, seinen achtzehn Kapellen und seiner einzigen ABC-Schule ein so ungeheures, steinernes Gefängniss hat, dass es die ganze Einwohnerschaft beherbergen könnte.
Der Gouverneur war der General Morreno, ein alter Soldat von ächt castilischem Stamme — stolz auf sein Blut, auf seine Töchter, auf sich selbst, auf seine Würden, kurz auf Alles, aber demungeachtet voll Wohlwollen und Gastfreundlichkeit. Sein Haus stand Allen offen (das heisst, so fern sie sich weissen Blutes rühmen konnten) und die Zeit entschwand mir wie ein ununterbrochener Festtag, indem ein Vergnügen dem anderen folgte — die Musik dem Tanze und das Augenspiel dem Kusse, ebenso wie die Limonade dem Wein oder die Crêmes den Trauben und Pfirsichen. Unglücklicherweise hat aber die Natur in unserer Bildung einen Missgriff begangen, und leider muss der Mensch nach dem Vergnügen eben so gut ausruhen, als nach der Arbeit. Das ist recht Schade, denn das Leben ist kurz, und durch den Schlaf wird so viele Zeit verloren; so dachte ich wenigstens, als ich achtzehn Jahre alt war.
Monterey ist eine sehr alte Stadt und wurde im siebenzehnten Jahrhuudert von einigen portugiesischen Jesuiten gegründet, welche hier einen Missionsposten anlegten. Den Jesuiten folgten die Franziskaner, gute, milde, träge und freundliche Leute, die den Scherz liebten, ohne der Sittlichkeit nahe zu treten, gegen Laster und Liebe donnerten, aber doch völlige Absolution ertheilten und leichte Bussen auflegten. Diese Mönche wurden von der mexikanischen Regierung verjagt, weil sie ihren Reichthum zu besitzen wünschte. Es war ein Unglück für Monterey, denn statt der gütigen, gastfreundlichen und edelmüthigen Ordensgeistlichen erschienen Agenten und Beamte der Regierung aus dem Innern, welche durch nichts an ihren neuen Aufenthalt geknüpft waren und sich wenig um das Glück der Bewohner kümmerten. Die Folge davon ist, dass die Californier dieser Bedrücker herzlich müde sind; sie haben einen natürlichen Widerwillen gegen Zollbeamte und können sich namentlich nicht mit dem Gedanken versöhnen, zu Führung der mexikanischen Könige, die für sie kein Interrsse haben, ihre Dollars herzugeben. Eines Morgens — es wäre ihnen beinahe schon einmal gelungen — werden sie die mexikanische Flagge von dem Präsidio herunternehmen, Kommissarien und Zollbeamte fortjagen, sich von Mexiko unabhängig erklären und ihre Hafen allen Nationen öffnen.
Monterey enthält ungefähr dreitausend Seelen, einschliesslich der Halbzucht und der Indianer, welche sich in den verschiedenen Wohnungen als Dienstboten gebrauchen lassen. Die Einwohner sind reich, und da sie keine Gelegenheit haben, ihr Geld nach Weise der östlichen Städte zu verschleudern — denn ihre Vergnügungen kosten sie nichts — so halten sie viel auf Ausschmückung ihrer selbst, ihrer Pferde und Sättel, und verwenden darauf soviel, als sie zu erschwingen vermögen. Ein Sattel im Preise von hundert Pfunden ist unter den reicheren jungen Leuten, die auf ihre Rosse und deren Geschirr stolz sind, etwas sehr Gewöhnliches.
Das weibliche Geschlecht kleidet sich reich und mit bewunderungswürdigem Geschmack. Die Mädchen tragen weisse Atlaskleider und lassen ihr langes, schwarzes Haar über die Schultern niederfallen. Zu Hause ist ihre Stirne mit reichem Juwelenschmuck geziert, wenn sie aber ausgehen, bedecken sie ihr Gesicht mit einem langen, weissen Schleier, durch den ihre Augen wie Diamanten funkeln.
Die verheiratheten Frauen ziehen eine bunte Tracht vor und befestigen ihr Haar vermittelst eines grossen Kammes dicht am Kopfe. Sie besitzen auch noch eine andere bezaubernde Eigenthümlichkeit, welche sie jedoch mit den Männern gemein haben — ich meine eine schöne Stimme, weich und tremulirend bei den Weibern, reich, kräftig und majestätisch aber bei ihren Herren. Ein amerikanischer Reisender sagt irgendwo: „Ein gemeiner Ochsentreiber zu Pferd, der einen Auftrag übernimmt, scheint wie ein Gesandter in einer Audienz zu sprechen. Die Californier sind in der That ein Volk, auf denen ein schwerer Fluch lastet; sie haben Alles verloren, nur nicht ihren Stolz, ihre Sitten und ihre Stimme.
In Monterey folgt eine Belustigung der andern, und zwischen Hahnenkämpfen, Wettrennen, Fandangos, Jagen, Fischen, Rudern und so weiter entschwindet die Zeit. Das Klima ist merkwürdig gesund; Epidemien hat es nie gegeben und man weiss überhaupt kaum, was Krankheit ist. Kein Zahnweh, kein sonstiges Leiden, kein Spleen; die Leute sterben an Zufälligkeiten oder an Altersschwäche. In der That geht zu Monterey ein eigenthümliches Sprüchwort: „El que quiere morir, que se vaya del pueblo“ — das heisst: „wer zu sterben wünscht, muss die Stadt verlassen.“
Während meines dortigen Aufenthalts hatte ich ein ziemlich gefährliches Abenteuer zu bestehen. Die Bay ist eine der schönsten von der Welt, ungefähr vierundzwanzig Meilen lang und achtzehn breit, und ich hatte mich mit einigen meiner Freunde einer grossen Partie angeschlossen, welche an der Mündung derselben fischen wollte. Der Missionär Padre Marini, der sich nicht ganz wohl fühlte, meinte, die Seeluft könnte ihn wohl bekommen, und schloss sich deshalb unserer Gesellschaft an. Wir hatten viele Boote; das, in welchem der Padre und ich Platz gefunden hatten, war ein hübsch geformtes, kleines Ding, welches zu einem amerikanischen Schiffe gehörte. Es wurde mit zwei Rudern in Bewegung gesetzt und hatte einen kleinen Mast nebst Segel.
Unser Fischen nahm einen guten Fortgang; wir waren Alle sehr vergnügt und gingen an’s Land, um etliche unserer Opfer zum Nachmittagsmahl zu braten. Im Laufe des Gesprächs kam Jemand auf einige alte Ruinen zu reden, die sich fünfzehn Meilen nördlich an der Mündung eines kleinen Flüsschens befänden. Der Missionär war begierig, Einsicht davon zu nehmen, und wir beschlossen, unsere Begleiter nach Monterey zurückkehren zu lassen, während wir Beide an Ort und Stelle übernachten wollten, um am andern Morgen einen Ausflug nach den Ruinen zu machen. Wir erhielten von einem andern Boot einen grossen steinernen Wasserkrug, zwei Decken und eine Doppelflinte. Sobald sich unsere Begleiter entfernt hatten, ruderten wir nach der Nordspitze der Bay, wählten uns ein passendes Nachtquartier, bauten, uns mit den Rudern, dem Mast und dem Segel eine Art Obdach, zündeten ein Feuer an und machten’s uns bequem. Es war einer jener schönen, milden Abende, die man nur in der Bay von Monterey findet; der sanfte, duftige Wind säuselte leise durch die Blätter, und mit dem Eintritte der Nacht, als der silberne Mond mit Myriaden Sternen über uns blinkte, kam der Missionär, nachdem er die Scene in langem Schweigen betrachtet hatte, auf die Vergangenheit und andere Klimas zu sprechen.
Er erzählte von Hurdwar, einem fernen Missionsposten im Norden von Indien, dicht an den Himalayas. Die Hindus nennen den Ort „Stadt der tausend Paläste“ und sagen, sie sey von den Genien an derselben Stelle erbaut worden, wo Vishnu nach einer seiner geheimnissvollen Verwandlungen, in welcher er Siva oder Sahavedra, den Geist des Bösen, besiegte, mehrere Wochen ausgeruht habe. Obgleich weniger bekannt, ist Hurdwar doch ein weit heiligerer Ort als Benares. Einmal im Jahre kommen hier Leute aus allen Gegenden zusammen, um mehrere Tage lang in den reinigenden Fluthen des Ganges ihre Waschungen vorzunehmen. In dieser edlen Stadt wird auch eine der grössten indischen Messen — vielleicht die grösste in der ganzen Welt — abgehalten, und da diese in denselben Monat fällt, in welchem die andächtigen Hindus ihre Wallfahrten vornehmen, so stellen sich auch zahlreiche Karavanen aus Persien, Arabien, Kaschmir und Lahore ein, um längs der Ufer des Flusses ihre Bazars zu errichten, die eine viele Meilen lange Strasse bilden. Die Menschenmasse, die sich zu solchen Zeiten zusammenfindet, soll mehr als eine Million Köpfe betragen.
Der Padre Marini hatte dort mehrere Jahre ganz allein als Missionär gewirkt. Seine bekehrte Heerde war freilich nur klein, und er hatte wenig