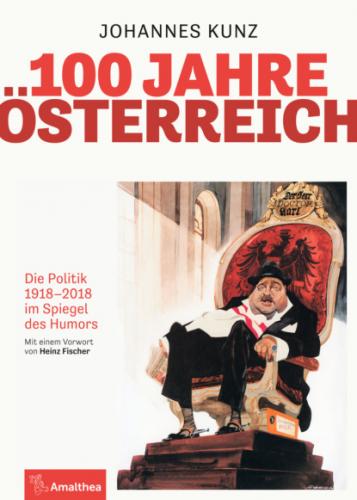»Aber ich bitt’ Sie! Wer soll die denn gemacht haben? Vielleicht der Herr Trotzki, der Schachspieler vom Café Central?«
Der aus Wien stammende Soziologe Paul F. Lazarsfeld zu diesem Thema: »Erfolgreiche Revolutionen wie in Russland brauchen Ingenieure, gescheiterte Revolutionen wie in Österreich brauchen hingegen Psychologen.«
Wissen Sie übrigens, woran man in Wien eine Revolution erkennt? – Wenn die Ringwagen über die Zweierlinie fahren.
Die Republik ohne Republikaner
Der verlorene Erste Weltkrieg, der für Franz Kafka »aus einem entsetzlichen Mangel an Phantasie entstanden« ist, bedeutete nach mehr als 600 Jahren das Ende des Habsburgerreiches. Alexander Lernet-Holenia kam zu dieser Erkenntnis: »Nie noch ist eine Monarchie an ihren Monarchen, immer noch ist sie an ihren Monarchisten zugrunde gegangen.« Am 11. November 1918 verzichtete Kaiser Karl I., der Großneffe Franz Josephs, »auf jeden Anteil an den Staatsgeschäften« und verabschiedete sich mit seiner Familie via Schloss Eckartsau und der Schweiz in Richtung Madeira. Am selben Tag starb übrigens Dr. Victor Adler. Tags darauf wurde die Republik ausgerufen. Dieser Rumpfstaat zählte nur noch sechs Millionen Bürger. Karl Kraus befand: »Es ist an sich eine unerträgliche Vorstellung, als Einwohner eines Kleinstaates mit einem derartigen Übermaß an Vergangenheit konfrontiert zu werden.« Er blickte im Groll zurück, indem er die Kaiserhymne umdichtete: »Gott erhalte, Gott beschütze vor dem Kaiser unser Land …« Die »gute alte Zeit« war jedenfalls endgültig vorbei, von der Karl Farkas sagte, sie verdanke ihr Renommee ohnedies nur dem Umstand, dass ältere Leute schon ein schlechtes Gedächtnis haben.
Der sozialdemokratische Staatskanzler Dr. Karl Renner sah Österreich als »eine Republik ohne Republikaner« und sagte später einmal: »Ich weiß nicht, ob wir uns getraut hätten, die Republik auszurufen, wenn der alte Kaiser Franz Joseph noch gelebt hätte.« Bei den Friedensverhandlungen in St. Germain 1919 fielen seitens des französischen Ministerpräsidenten Georges Clemenceau die berühmten Worte »der Rest ist Österreich« bezüglich der Aberkennung des Großteils der Gebiete der versunkenen k. u. k. Monarchie. Viele Bürger dieser »Republik Deutschösterreich« hielten den Rumpfstaat nicht für lebensfähig und suchten »Anschluss« beim großen Nachbarn. Es mangelte den Österreichern an Selbstvertrauen, dafür hatten sie – nicht zuletzt wegen der großen wirtschaftlichen Probleme – viel Selbstmitleid.
Für Friedrich Torberg war der Untergang des alten Österreich »eine der katastrophalen Humorlosigkeiten der Weltgeschichte«. Dennoch oder vielleicht gerade deshalb boomte der Humor in den ersten Jahren der jungen Republik. So ist es immer, wenn es den Menschen schlecht geht. In Wien gab es zeitweise bis zu 25 Kellertheater, in denen politisches Kabarett geboten wurde. In den 1920er- und 1930er-Jahren setzten Fritz Grünbaum und Karl Farkas im »Siplicissimus«, von den Wienern liebevoll »Simpl« genannt, Meilensteine der Kleinkunst. Beide entwickelten damals die legendäre Doppelconférence. Dazu Farkas zu seinem Partner Grünbaum: »Man nehme einen äußerst intelligenten, gutaussehenden Mann, das bin ich, und einen zweiten, also den Blöden. Das bist, nach allen Regeln der menschlichen Physiognomie, natürlich Du!«
Zwei gesellschaftliche Gruppen kommen mit der neuen Republik besonders schlecht zurecht: der Adel und die Offiziere der alten k. u. k. Armee. Treffen einander zwei pensionierte Generäle im Café Sacher in Wien. Der eine Stammtischstratege: »Zurück hätten wir gehen müssen, von Anfang an zurück!«
Darauf der andere: »Dann wären die Russen doch über die Karpaten gegangen!«
Der Erste: »Das macht nichts. Zurück hätten wir gehen müssen.«
»Aber dann wären sie womöglich über die Leitha nach Österreich gekommen.«
»Macht nichts. Zurück hätten wir gehen müssen.«
»Also jetzt versteh’ ich Dich gar nicht mehr! Dann hätten die Russen doch Wien belagert oder sogar eingenommen!«
»Das macht alles nichts. Aber die Armee war’ intakt geblieben!«
In Graz, das man in jenen Jahren »Pensionopolis« nennt, weil hier zahlreiche ehemalige Offiziere und hohe Beamte ihren Lebensabend verbringen, sitzen ein früherer Feldmarschall und dessen ehemaliger Adjutant bei einer Schale Gold im Hotel Erzherzog Johann. Die langen Virginier-Zigarren qualmen und die beiden alten Herren ergehen sich, nachdem sie die Tagesfragen in militärischer Kürze erledigt haben, in Reminiszenzen an die k. u. k. Armee.
»Weißt, lieber Freund«, sagt der pensionierte Feldmarschall nach einer Weile gedankenvoll, »wenn man bedenkt, was wir für eine herrliche Armee gehabt haben, für eine wunderbare Armee – was sag’ ich, die fabelhafteste Armee der ganzen Welt! Und was machen die Trotteln mit der Armee? In den Krieg haben sie’s g’schickt!«
Im Zug von Wien nach Graz sitzt ein pensionierter General der k. u. k. Armee in Zivil und trägt am Revers seines Sakkos das militärische Verdienstkreuz. Bei einer Station steigt ein galizischer Jude zu, der zur Verblüffung des Generals das gleiche Verdienstkreuz am Sakko trägt. Auf seine Frage, wie der Jude zu einem solchen Orden komme, antwortete dieser auf Jiddisch: »Ich hob geliefert Weizen far dem Militär, hot men mir dus gegeben! Und wus hat Ihr geliefert?«
Der General mit stolzgeschwellter Brust: »Ich habe Schlachten geliefert!«
»Un wus meint Ihr, ich hob giten geliefert?« (»Und meinen Sie, ich hätte guten geliefert?«)
In der neuen Republik wird der Adel per Gesetz abgeschafft. Daraufhin lässt sich Adalbert Graf Sternberg neue Visitenkarten drucken: »Adalbert Sternberg aus jenem Geschlecht, welches im Jahre 800 von Karl dem Großen geadelt und im Jahre 1919 von Karl Renner entadelt wurde.«
Viele einstige Aristokraten verlieren nicht nur Titel und Ansehen, sondern steigen auch materiell ab. Klagt ein früherer Baron: »Wenn ich mir mit meinem Stammbaum wenigstens einheizen könnt’!«
Und ein Wiener Hotelier über die Herkunft seines Personals: »Seh’n Sie, mir ham’s zu was bracht: Unser Liftbua is a junger Graf, der Kutscher war a Oberleutnant, a Prinz von Geblüt putzt die Stiefeln und unser Stubenmadel is a ehemalige Comtess!«
Herr und Frau Wamperl führen ein politisches Gespräch.
Sie: »Geh, sag amal, Alter, was is denn das eigentlich, a Republik?«
Er: »Na hörst, schamst Di net, dass Du des net waaßt? A Republik, das kann i Dir ganz genau sagen, a Republik, das is – wie soll i denn nur g’schwind sagen – a Monarchieersatz!«
Diese Zeichnung zum Beiblatt der »Muskete« vom 22. April 1920 von Fritz Gareis beschreibt die wirtschaftliche Not und Armut im Österreich der Nachkriegszeit.
Ein Antirepublikaner bekennt offenherzig: »Nein, ich kann nie ein Republikaner werden, wenn ich bedenke, dass ich beim Zusammenbruch der Monarchie gerade an der Reihe war, den Franz-Josephs-Orden zu bekommen!« Orden spielen in Wien seit jeher eine große Rolle. Wie in dieser Stadt üblich, wird ein Beamter vor seiner Pensionierung noch mit einem Orden ausgezeichnet. »Was ham’s denn Besonderes g’macht, dass Sie so an schönen Orden kriegt ham?«, fragt einer. »Nix«, antwortet der Ausgezeichnete. »Aber das dafür lang.«
Bei der Wahl zur Konstituierenden Nationalversammlung am 16. Februar 1919 erreichen die Sozialdemokraten 72 Mandate und werden zur stärksten Partei vor den Christlich-Sozialen mit 69 Sitzen. Dazu findet sich in den »Wiener Stimmen« folgender Kommentar: »Zwischen Herrschen und Regieren ist doch ein Unterschied – das sieht man an der neuen Mehrheitspartei.«