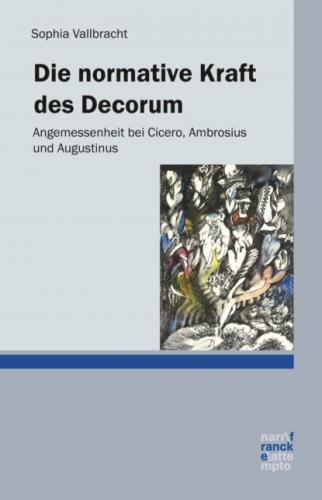Aristoteles’ Schüler Theophrast ist laut Diogenes Laertius (Leben und Meinungen berühmter Philosophen V, 38) von Aristoteles aufgrund seiner göttlichen und treffenden Ausdrucksweise von Tyrtamos in Theophrast umbenannt worden. Damit scheint er prädestiniert für die Erweiterung der aristotelischen Stillehre in vier Stiltugenden: ἑλληνισμός (Sprachrichtigkeit), σαφήνεια (Deutlichkeit), κατασκευὴ (Gestaltung/Redeschmuck) und πρέπον (Angemessenheit)18. Das Angemessenheitspostulat des Theophrast fordert den Ausschluss von Anstößigem jeglicher Art, wie beispielsweise Schwächen von Menschen im Gespräch aufzudecken, die kein Gefühl für das πρέπον entwickelt haben. In diesem Sinne zeichnet er den Charakter des gebildeten Menschen (πεπαιδευμένος) laut Fortenbaugh als denjenigen, der „ein Auge für das πρέπον hat“19.
Interessant für die etymologische Begriffsbestimmung des πρέπον im Altgriechischen ist auch Dionysius von Halikarnassus’ Werk De compositione verborum. In diesem griechischen Literaturkritiker aus der Wende des Jahrtausends verbinden sich griechische und römische Sprachkunst. Als Grieche lebte er lange Zeit im augusteischen Rom und verfasste rhetorische Schriften über die großen Redner Athens, wie Lysias und Demosthenes, die primär für Lehrer und Schüler der Kompositionslehre und Grammatik geschrieben waren. Nach Kennedy ist sein Werk „On Literary Composition [...] the most detailed account we have of how educated Greeks reacted to the beauties of their native language.“20 In diesem detaillierten Bericht über die Schönheit der altgriechischen Sprache werden vier Ursachen für deren Schönheit angegeben: μέλος (Melodie), ῥυθμός (Rhythmus), μεταβολή (Vielfalt) und πρέπον (Angemessenheit) (De compositione verborum 11). Besondere Betonung legt er in De compositione verborum (12) dabei auf das πρέπον, das determiniert, dass das „setting“ dem Redegegenstand angemessen und schicklich sein muss. Als wichtigstes Element einer Rede neben vornehmem Klang, herrschaftlichem Rhythmus und eindrucksvoller Vielseitigkeit ist das πρέπον ausgemacht, dessen diese drei bedürfen. Und so ist seine Definition von πρέπον als Hauptquelle literarischer Schönheit im 13. Kapitel seines Werkes ein ästhetisch-linguistischer Beitrag in Anbindung an Platon und Aristoteles.
Fasst man das altgriechische Konzept der Angemessenheit als rhetorisches Phänomen und Prinzip auf, darf nach πρέπον auch εἰκός nicht fehlen, dessen Bedeutung auch logische Wahrscheinlichkeit impliziert. In der Hauptepisode der Homerischen Hymnen wird diese Bedeutungsnuance deutlich, wenn argumentiert wird, dass Hermes nicht als Räuber der Kühe des Apollon gelten kann, da er als Baby einem Räuber nicht ähnelte, er ist also wahrscheinlich nicht der Täter. Bereits hier kann „Ähnlichkeit“ im Zusammenhang mit „logischer Wahrscheinlichkeit“ gedeutet werden. Εἰκός ist das Partizip Neutrum der (zweiten) Perfektform von ἔοικα mit präsentischer Bedeutung für „wahrscheinlich oder ähnlich sein“ und wird auch oft in der substantivierten Form als Nomen τό εἰκός für „Wahrscheinlichkeit, Glaubwürdigkeit und Angemessenheit“ verwendet. David C. Hoffman hat als älteren Hauptsinn von εἰκός „ähnlich sein“ bestimmt, das sich in Urteilen zur Angemessenheit in „To be similar to what is socially expected“ und in Urteilen über die Wahrheit von Begebenheiten in „To be similar to what is known to be true“ und in „To seem“ wandeln kann.21 In der Bedeutung der Angemessenheit schwingt implizit meist ein Vergleich mit: angemessen in Bezug auf etwas. Hoffman teilt in seinem Artikel diese Bezüge in Sitte (engl. custom), Recht (justice), Charakter und soziale Postition (character/position) und Sachlage oder Umstände (circumstance) auf. Die Verbindung mit dem Vergleich ist nicht nur der Übersetzung geschuldet, sondern leitet sich auch aus dem Altgriechischen ab, das das Perfekt ἔοικα mit einer Dativ-Ergänzung vergleichend („ähnlich sein; gleichen“) und ohne Dativ, in absoluter Verwendung, normativ benutzt („angemessen sein“).22 Manfred Kraus führt als weitere Verwendung (S. 130) diejenige Platons im Phaidros (272d-273d) an, der εἰκός nicht als Wahrheit, sondern als das der Wahrheit Ähnliche, als das Glaubwürdige (τὸ πιθανόν) und als Meinung der Masse (τὸ τῷ πλήθει δοκοῦν) definiert. Als Äquivalent dazu dient das Adjektiv ἐπιεικής („schicklich, angemessen, geziemend“), das sich entweder in attributiver Position auf ein Nomen bezieht oder wie bei Homer, in parenthetischer Verwendung ὡς ἑπιεικές („wie es sich gebührt“) mit Infinitiv oder Accusativus cum Infinitivo auftaucht. Für Kraus (S. 136) ist das εἰκός in absoluter Verwendung (ohne eine Dativergänzung) mit der Bedeutung von ἑπιεικές identisch und zeigt auf, dass das εἰκός dasjenige billigt, das mit dem sozial und ethisch Erforderlichen in Einklang ist. Alle diese etymologischen Erkenntnisse, Verbindungen und Bedeutungsvarianten zeigen nach Kraus ein genuin rhetorisches Konzept von εἰκός auf, das eben nicht auf der Nähe zur Wahrheit beruht, sondern auf der Nähe zur Erfahrung des Publikums, zu dessen emotionaler Empfänglichkeit und zu seinen Verhaltensformen.23
2.2 Römische Etymologie: decorum, aptum, proprium, accommodatus und convenit
Auf dem altgriechischen Konzept des πρέπον aufbauend, ist es besonders Cicero zu verdanken, dass er griechisches Gedankengut aus Athen nach Rom importiert und in das römische decorum-Konzept integriert hat. Während die Griechen sich mit den zeitlichen und situativen Ausprägungen des πρέπον beschäftigten, spielen im römischen decorum nicht nur rhetorische und intellektuelle, sondern auch moralische Fähigkeiten im Rahmen der societas hinein. Ciceros Übertragung des Begriffs „πρέπον“ in De officiis I, 93 und im Orator, 70 ins lateinische „decorum“ bedeutet einen inhaltlichen Anfangspunkt, von welchem sich Cicero, Horaz und Quintilian lösen werden, um je eigene Überlegungen anzustellen. Die Bedeutungsentwicklung des ciceronischen decorum-Konzeptes ist wirksam bis in die Renaissance hinein (beispielsweise bei Puttenham, Ascham, Castiglione oder Shakespeare).
Analog zum altgriechischen Begriffsfeld wird auch in der lateinischen Terminologie das Angemessenheitskonzept in den einzelnen Werken von Cicero bis Quintilian anhand eines Begriffsfeldes im Rahmen des decorum