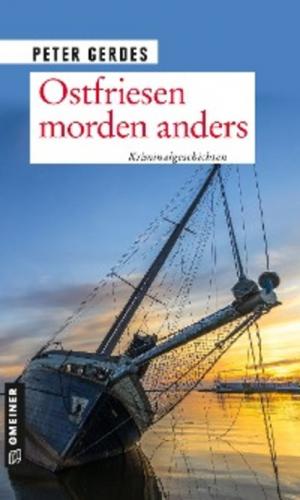Don Cemento
Stirnrunzelnd betrachtete Antonio seine neue Pizzeria in der Altstadt. Okay, noch war es nur ein verkommener alter Laden, daher hatte er das Haus ja so günstig bekommen. Bis zur Eröffnung gab es noch eine Menge zu tun. Antonio aber scheute keine Arbeit. Ohne Arbeit kein Profit.
Don Pasquale sah das anders. »Schutzgeld ist fällig«, knurrte er, als er Antonio aufsuchte, zwei Wochen vor der Eröffnung.
Antonio wischte sich den Schweiß von der Stirn, mit dem Handrücken, denn seine Finger waren krustig vom Kalk. »Und wenn ich nicht zahle?«, fragte er trotzig.
Don Pasquale lachte böse und schob sich seinen cremefarbenen Hut in den Nacken. »Dann gehst du zu den Fischen.« Er zeigte auf Antonios Mörtelkübel. »Mit Schuhen aus Beton! Alte Tradition. Praktisch, so dicht am Hafen. Man nennt mich auch Don Cemento, wusstest du das nicht?«
»Ist ja gut«, sagte Antonio. »Ich hol schon das Geld.« Aber als er sich wieder zu Don Pasquale herumdrehte, hatte er kein Geld in der Hand. Fluchend griff der Don nach seiner Pistole. Da sauste etwas auf ihn zu.
Die Eröffnung war ein voller Erfolg. Auch die Zeitung war da. »Das haben Sie alles selber gemacht?«, staunte der Reporter. »Das war bestimmt eine Menge Arbeit. Allein der große Steinofen!«
»Oh ja«, nickte Antonio. »Vor allem das Betonfundament. Aber dafür hält das auch ewig.«
Für das Pressefoto stellte er sich mit dem langen Pizzaschieber in Positur. Dessen Kante hatte er vorher sorgfältig abgewischt.
Der fremde Zwilling
Alles begann im Supermarkt, als sich plötzlich ein wildfremder älterer Mann zu ihr herüberbeugte und ihr vertraulich seinen Arm um die Schultern legte. »Mein Durchfall ist deutlich besser geworden«, raunte er ihr zu, nickte noch einmal mit hochgezogenen Augenbrauen und schob seinen Einkaufswagen in Richtung Spirituosen.
Sie war viel zu erschrocken, um zu protestieren oder um Hilfe zu schreien, wonach ihr eigentlich zumute war. So lächelte sie nur irritiert und nickte dem abschiebenden Senior reflexhaft hinterher. Gütiger Himmel, was war denn das? Hatte die Klapse heute Tag der offenen Tür? Oder hatten sie hier im Supermarkt einen Dementen-Nachmittag eingeführt?
Das Rätsel löste sich erst in Runde vier. Bis dahin hatte ihr ein sportlicher, aber völlig verschleimter junger Mann etwas vorgehustet und eine übergewichtige Matrone hatte ihr ihren Ausschlag unter die Nase gehalten. Beide Male war Evelyn Wattjes viel zu erschrocken gewesen, um sich solche Aufdringlichkeiten zu verbitten. Erst die vierte dieser unheimlichen Begegnungen verlief anders.
Die Frau mit der Nagelbettentzündung war ihr im Leeraner Evenburg-Park über den Weg gelaufen. Sie hatte sich ihr lächelnd von vorne genähert statt überfallartig von hinten oder von der Seite. So waren ihr Evelyns Stirnrunzeln und ihre abwehrende Haltung nicht entgangen. »Ach, Sie sind es ja gar nicht!«, rief sie nach kurzem Zögern aus.
»Wer soll ich nicht sein?«, schnauzte Evelyn Wattjes zurück. Wenn man ihr quer kam, kannte sie kein Pardon. Und ihre Existenz anzuzweifeln, das war mehr als quer.
»Meine Apothekerin!« Die Unbekannte lächelte entschuldigend. »Ich hab erst gedacht, Sie wären sie! Sie sehen ihr unglaublich ähnlich.« Peinlich berührt, versuchte sie ihre geröteten und geschwollenen Finger, die sie Evelyn zur Begutachtung entgegengestreckt hatte, hinter dem Rücken zu verbergen. »Aber wenn Sie sprechen, merkt man es. Tut mir leid, nichts für ungut.« Die Frau wandte sich zum Gehen.
»Welche Apotheke denn?«, rief Evelyn ihr hinterher.
»Na, da hinten, an der Hauptstraße!« Die Frau machte eine vage Handbewegung und eilte davon. Evelyn Wattjes aber hatte schon verstanden.
Gut, dass es von der Evenburg bis zur Hauptstraße ein gutes Stück zu laufen war. So hatte sie Zeit zum Nachdenken. Als sie die Apotheke erreicht hatte, stürmte sie nicht hinein, sondern trat ans Schaufenster und inspizierte das Innere über die Auslagen hinweg. Es war, als würde sie in einen Spiegel blicken. Die Frau dort hinter dem Tresen, in dem weißen Kittel, mit den halblangen, noch kaum ergrauten brünetten Haaren, den grauen Augen, den runden Wangen und dem Grübchen im Kinn – wenn das nicht sie war, wer war es dann?
Sie betrat die Apotheke auch jetzt nicht, sondern ging schnurstracks nach Hause, ihren Vater befragen.
Sie hasste ihren Vater seit frühester Jugend, weil der sich immer nur einen Sohn gewünscht hatte – ein Wunsch, den ihre Mutter ihm nicht hatte erfüllen können und unter dem sie immer gelitten hatte. Einen Sohn und Erben für die Firma, die er aufgebaut hatte und die ihm das Wichtigste auf der Welt war. Mutter war dann früh gestorben, und Evelyn Wattjes hatte gleich nach dem Abitur Ostfriesland verlassen, war in der Anonymität des Ruhrpotts untergetaucht und hatte sich so bald wie möglich auf eigene Füße gestellt. Berufliche Selbstständigkeit – das war ein Wunsch, den sie vom Vater übernommen hatte. Und was der konnte, das konnte sie doch wohl auch!
In diesem Punkt allerdings hatte sie sich getäuscht. Nach kurzem Boom und tiefem Absturz stand sie ohne Firma, aber mit einem riesigen Berg Schulden da. Privatinsolvenz, putzen gehen, im Billigmarkt an der Kasse sitzen. Ihr war nichts erspart geblieben. Obwohl sie sich das bestimmt hätte ersparen können. Aber den Gedanken, ihren reichen Vater um Hilfe zu bitten, erstickte sie im Keim. Alles lieber, als bei dem angekrochen zu kommen!
Jahre später kam dann er bei ihr angekrochen.
Vater war krank, unheilbar krank, hatte seine florierende Firma längst vorteilhaft verkauft und lag jetzt in einem eigens und perfekt eingerichteten Krankenzimmer in seiner Logaer Villa, wo er auf den Tod wartete. Der sicher noch einige Zeit auf sich warten lassen würde, denn Bertram Wattjes konnte sich jede erdenklich ärztliche Behandlung leisten. Auch in das edelste aller Pflegeheime hätte er sich locker einkaufen können. Das aber wollte er nicht. Er wollte seine letzten Jahre in seinem eigenen Haus verbringen, betreut von seiner eigenen Tochter.
Alles in Evelyn sträubte sich dagegen, dieses Angebot anzunehmen. Aber es war einfach zu verlockend. Nicht nur freie Unterkunft und Verpflegung, auch ein regelmäßiges Gehalt stellte Vater ihr in Aussicht, außerdem Unterstützung durch professionelle Pflegekräfte, die ihr zuarbeiteten und ihr freie Nächte und Wochenenden verschafften. Trotzdem hätte sie sicherlich nein gesagt, nach all der Ablehnung, die sich als Kind und Jugendliche empfunden und all dem Hass, der sich bei ihr angestaut hatte. Aber Vater wäre nicht Vater gewesen, wenn er das nicht einkalkuliert hätte. Er verband das Angebot mit einer Daumenschraube: Entweder Evelyn kam, dann blieb ihr Name in seinem Testament stehen – oder sie kam nicht, dann würde er sie aus seinem letzten Willen streichen.
Nur das nicht! Die Hoffnung auf ein reiches Erbe war das Einzige gewesen, was Evelyn in langen Jahren wirtschaftlicher Not bei der Stange gehalten hatte. Natürlich wusste sie, dass sie einen Pflichtteil erhalten würde; angesichts der Höhe ihrer Schulden aber würde der vermutlich nicht reichen, um ihr eine sorgenfreie Zukunft zu gewährleisten.
Vater hatte ihr ein Angebot gemacht, das sie nicht ablehnen konnte. Zähneknirschend nahm sie es an.
Die ersten Monate verliefen gar nicht so schlecht. Die meiste Arbeit erledigten die polnischen Pflegerinnen; ihre eigene Funktion war mehr die einer gehobenen Gesellschaftsdame. Nur, wenn sie mit ihm allein war, kommandierte er sie herum wie in alten, bösen Zeiten. Also hielt sie diese Phasen so knapp wie möglich. Sie war kurz davor, sich mit ihrer neuen Lebenssituation anzufreunden, als die merkwürdigen Begegnungen begannen.
»Vater, wer ist diese Frau? Und versuch gar nicht erst zu leugnen. Solch eine Ähnlichkeit kann kein Zufall sein.«
Bertram Wattjes seufzte. »Was soll ich lange drum herum reden«, sagte er mit heiserer, aber fester Stimme. »Ja, Eva ist meine Tochter. Ebenso wie du. Sie ist ein Jahr jünger.« Er seufzte. »Weißt du, deine Geburt war mit Komplikationen verbunden, und danach teilten die Ärzte deiner Mutter mit, dass sie nie wieder ein Kind bekommen konnte. Was glaubst du, wie verzweifelt wir waren! Ich hatte mir doch so sehr einen Erben