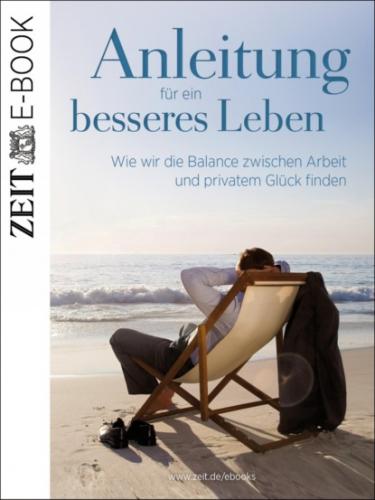Man kann sich einen durch Arbeit verursachten psychischen Kollaps wie einen Infarkt vorstellen. Nur dass es nicht das Herz ist, das das geforderte Tempo nicht mehr hält, sondern die Seele. Ebenso wie die Herzleiden haben sich die psychischen Gebrechen zu modernen Volkskrankheiten entwickelt. »In beiden Fällen ist es falsch, nach der einen entscheidenden Ursache zu suchen«, sagt der Psychiater Hans-Peter Unger, Chefarzt der Asklepios Klinik in Hamburg-Harburg. »Es gibt jedoch Risikofaktoren, die eine Erkrankung wahrscheinlicher machen.«
Beim Herzinfarkt sind das: Rauchen, schlechte Ernährung, Bewegungsmangel. Auch beim Burn-out, dieser Erschöpfungsdepression, oder dem Nervenzusammenbruch erhöhen naheliegende Dinge die Gefahr: ein diktatorischer Chef zum Beispiel, intrigante Kollegen oder ein Hang zum Perfektionismus. Phänomene also, die es schon immer gab, die nie verschwinden werden.
Darüber hinaus aber spiegelt die steigende Zahl seelischer Erkrankungen auch Veränderungen in der Arbeitswelt wider, nicht nur in Deutschland, sondern rund um die Welt. »Auch in Frankreich, Amerika und Japan nehmen die psychischen Erkrankungen von Erwerbstätigen zu, genauso wie in den aufstrebenden Wirtschaftsnationen Brasilien und China«, sagt der Düsseldorfer Medizinsoziologe Johannes Siegrist.
So wie die Nadel eines Barometers auf steigenden Luftdruck anspricht, so scheint die Krankenstatistik auf den wachsenden Wettbewerbsdruck zu reagieren.
Kurz vor Weihnachten fährt Michael Kampmann* mit seiner Frau in den Skiurlaub. Ischgl in Tirol, endlich ein paar Tage frei. Kampmann, 60 Jahre alt, studierter Elektroingenieur, ist Vertriebsleiter bei einem norddeutschen Unternehmen für Gebäudetechnik. Ein schlanker, sportlicher Mann, der korrekt und verbindlich auftritt, der sagt, sein Chef soll sich auf ihn verlassen können. Egal, wie er gerade heißt.
Vor zehn Jahren wurde Kampmanns Firma von einem amerikanischen Konzern übernommen und umgebaut. Aus Abteilungen wurden Business Units, aus dem distanzierten Sie ein scheinbar freundschaftliches Du. Neue Manager bezogen ihre Büros, nur um wenig später anderen Führungskräften Platz zu machen, die ihrerseits nicht lange blieben. Der Vertriebsleiter Kampmann war es gewohnt, viel zu arbeiten, aber im Hin und Her der wechselnden Chefs verschwand auch der letzte Unterschied zwischen Werktag und Wochenende.
Eine neue Verkaufsstatistik, ein PowerPoint-Vortrag, ein paar Hundert E-Mails beantworten – früher hatte Kampmann die Arbeit im Büro gelassen, jetzt folgte ihm sein Büro überallhin. »Jeder hier hat eine Vodafone-Karte und einen Laptop, mit dem er auf alle Daten und Programme der Firma zugreifen kann«, sagt Kampmann.
Arbeiten, auch von zu Hause aus: Einst hieß das Telearbeit und galt als besonders menschenfreundlich. Heute zeigt sich, dass Handys und Kleincomputer wie Freizeitzerkleinerer wirken. Sie schaffen noch in den hintersten Ecken des Lebens neuen Platz für die Arbeit. Bis man ihr nicht mehr entkommt. Nicht einmal auf der Skipiste.
Kampmann ist gerade aus dem Lift gestiegen, als sein Handy klingelt. Sein Chef ist dran, es gehe um einen wichtigen Vertrag mit einem Kunden. Der müsse jetzt ausgehandelt werden. Sofort. Damit der Jahresabschluss besser aussieht.
Kampmann entschuldigt sich bei seiner Frau, fährt ins Tal, setzt sich an den Rechner und verbringt dort in den nächsten Tagen Stunde um Stunde. Den Laptop auf dem Schoß, das Handy am Ohr, verhandelt er von seinem Hotelzimmer in Ischgl aus mit einem Geschäftspartner, der, ein paar Hundert Kilometer entfernt, seinerseits im Urlaub in einem Hotelzimmer sitzt. Am 22. Dezember um zehn Uhr abends schließen sie nach weiteren Diskussionen mit Rechtsabteilungen und Vorgesetzten den Vertrag ab. »Das war mein Urlaub«, sagt Kampmann.
Und das ist seine Krankengeschichte: Tinnitus, Hörsturz, Schlafstörungen, Ruhelosigkeit, Burn-out, schließlich Depression. Wann er wieder arbeiten kann, ist unklar.
Auch Michael Kampmann ist jetzt in medizinischer Behandlung. Auch er ist zum Umsatzbringer in einer neuen deutschen Wachstumsbranche geworden: den Burn-out-Kliniken, Seelenhospitälern und Psychosanatorien, den Lazaretten der Arbeitswelt, die seit mehreren Jahren starken Zulauf verzeichnen.
In der Helios-Klinik Bad Grönenbach im Allgäu zum Beispiel gehören leidende Angestellte wie Michael Kampmann inzwischen zur Kernzielgruppe. Inmitten bayerischer Berge, zwischen Kühen und Kirchturm, reden sie hier mit Psychologen, malen Bilder, singen im Chor und versuchen fünf, sechs Wochen lang, die Arbeit aus ihren Köpfen zu vertreiben. »Die meisten, die zu uns kommen, sind hoch qualifiziert, sicher angestellt und materiell gut versorgt«, sagt Jochen von Wahlert, der Ärztliche Direktor. Sie sind Ingenieure, Banker, Ärzte, Manager, Anwälte. Erfolgreiche Leute, die sich auf einmal fragen, warum sie sich das angetan haben: den Druck, den Stress, das entmutigende Gefühl, zu rennen und sich doch keinem Ziel zu nähern. Ja, warum eigentlich? Auf den ersten Blick eine naive Frage. Natürlich kann der Vertriebsleiter Michael Kampmann nicht einfach in Streik treten, wenn sein Chef ihn anruft. Dennoch verbirgt sich hinter dem Einsatz vieler erschöpfter Dauerarbeiter, die irgendwann zusammenbrechen, ein interessantes Phänomen. Sie haben finanziell längst ausgesorgt. Sie besitzen Autos, Häuser, Grundstücke, von denen frühere Generationen nur träumen konnten. Ans Aufhören oder auch nur ans Kürzertreten denken sie trotzdem nicht. Weil es ihnen bei der Arbeit längst nicht mehr ums Geld geht.
Arbeitsgesellschaft. Diesen Begriff verwenden Soziologen, um Länder wie Deutschland in einem Wort zu beschreiben. Es sind Länder, in denen Berufsbezeichnungen auf Grabsteinen und in Todesanzeigen stehen und Menschen, die sich neu kennenlernen, als Erstes nach dem Beruf ihres Gegenübers fragen. Länder also, in denen Arbeit nicht nur Geld bringt, sondern vor allem Status, Ansehen, soziale Anerkennung. In denen Arbeit großes Glück verheißt – bevor sie mitunter ziemlich unglücklich macht.
Noch vor 30, 40 Jahren war das anders. Auch damals war der Beruf ein Ursprung von Erfüllung und Ansehen – aber nicht der einzige. Nach Feierabend saßen Millionen am Stammtisch, trafen ihre Kegelbrüder, Parteifreunde, Sportskameraden oder die Kollegen vom Kirchenvorstand.
Heute aber verlieren Parteien und Gewerkschaften ihre Mitglieder, Kirchen und Sportvereine schrumpfen. Die Quellen, aus denen Menschen Anerkennung schöpfen, trocknen aus. Nur eine wächst und sprudelt: die Arbeit. Nie zuvor gingen in Deutschland so viele Leute einer Erwerbstätigkeit nach wie heute. Wenn aber zum Beispiel eine Abteilungsleiterin nur noch an ihre Arbeit denkt, dann mag das, ökonomisch gesehen, ein karrierefördernder Wettbewerbsvorteil sein. Aus medizinischer Sicht ist es ein Risikofaktor. »Soziale Bindungen wirken wie Protektoren«, sagt der Arzt Jochen von Wahlert. »Die Familie, die Freunde, die Gemeinschaft in einer Kirche, all das erhöht den Schutz vor seelischer Erkrankung.«
Es war dieser Schutz, der Christiane Schöss* am Ende fehlte.
Sie ist Ende 30 und leitet die IT-Abteilung in einem Verlag mit 500 Mitarbeitern. Für sie ein Traumjob. Sie verdient viel Geld, bekommt außerdem Boni, Sonderprämien, Dienstwagen und einen Tiefgaragenstellplatz. Sie darf sich Chief Information Officer, kurz CIO, nennen und findet, dass sich das gut anhört. Sie lebt in der Großstadt, ist alleinstehend, hat keine Kinder, aber das kann ja noch kommen, jetzt will sie erst einmal etwas leisten, und außerdem hat sie ja einen großen Freundeskreis. Der kleiner wird. Und kleiner.
Es fängt damit an, dass sie Verabredungen absagt. Kino? Squash? Ein Ausflug mit ihrem Patenkind? Ein andermal. Zuerst sucht sie nach Entschuldigungen, später wird sie gar nicht mehr gefragt. Irgendwann trifft sie nach dem Büro eine Freundin auf einen schnellen Kaffee, als diese plötzlich schimpft: »Sag mal, du redest ja nur noch über deine Arbeit. Du hast überhaupt nichts anderes mehr im Kopf!«
Da, sagt Christiane Schöss, habe sie erstmals gemerkt, wie sehr sie alles andere im Leben beiseitegeschoben hatte. Einen Moment lang ist sie geschockt. Dann, wie aus Trotz, vertieft sie sich noch mehr in ihren Job. Gibt ja allen Grund dazu – neue Projekte, die Finanzkrise. Außerdem liebt sie ihre Arbeit. Irgendwann aber liebt ihre Arbeit sie nicht mehr. Die Geschäftsführung gibt ihr immer neue Aufträge, macht Druck, mäkelt an ihr herum. Ihr ist, als sei sie verlassen worden. Christiane Schöss ist immer noch CIO, aber sie hat nicht mehr das Gefühl, es geschafft zu haben. Es kommt ihr vor, als sei sie gescheitert.
Wenn sie jetzt abends nach Hause kommt, hat sie nicht einmal mehr die Kraft, die Waschmaschine anzuschalten. Sie fängt an zu weinen – wegen nichts. Kriegt Wutanfälle –