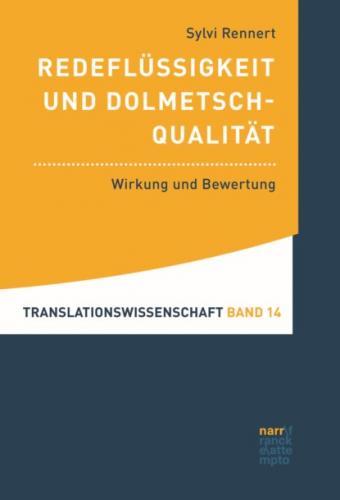2 Begriffsbestimmung
In diesem Kapitel sollen die für die vorliegende Arbeit zentralen Begriffe Qualität und Redeflüssigkeit definiert werden, was bei Begriffen, die beide von verschiedenen ForscherInnen wiederholt als „elusive“ bezeichnet wurden, keine leichte Aufgabe ist.
In den folgenden Abschnitten werden die Problematik der Definition sowie unterschiedliche Ansätze und Perspektiven beleuchtet und es wird dargelegt, wie die dieser Arbeit zugrundeliegenden Definitionen von Qualität als Wirkungsäquivalenz und Flüssigkeit als Funktion temporaler Variablen zustande kommen. Als erstes wird in Abschnitt 2.1 der Begriff der Qualität definiert. Dazu wird zunächst in 2.1.1 besprochen, aus wessen Perspektive die Qualität von Dienstleistungen im Allgemeinen und Dolmetschleistungen im Besonderen zu definieren ist. Darauf folgt in 2.1.2 ein Überblick über Qualitätsdefinitionen und 2.1.3 schließlich widmet sich der Operationalisierung der Qualitätsbegriffe für die Forschung. Anschließend wird in Abschnitt 2.2 die Redeflüssigkeit definiert, wobei auch hier zunächst in 2.2.1 ein Überblick über Definitionen geboten wird. In 2.2.2 werden die wichtigsten temporalen Variablen, aus denen sich Redeflüssigkeit nach der gewählten Definition zusammensetzt, beschrieben: Pausen, Unflüssigkeiten und Sprechgeschwindigkeit ist jeweils ein eigener Abschnitt gewidmet.
Aufbauend auf diesen Definitionen bietet Kapitel 3 einen Überblick über den Stand der Forschung zur Redeflüssigkeit beim Dolmetschen und die Qualitätsforschung in der Dolmetschwissenschaft, wobei vor allem die Überscheidungen dieser beiden Gebiete beleuchtet werden.
2.1 Qualität
Obwohl sich die Translationswissenschaft seit gut drei Jahrzehnten mit dem Thema Dolmetschqualität auseinandersetzt, gibt es dafür keine einheitliche Definition – und wie Garzone (2003: 23) feststellt, hat sich diese Schwierigkeit im Laufe der Zeit durch das Hinzukommen neuer, ganzheitlicher Betrachtungsweisen der Dolmetschsituation als Hypertext oder als Ergebnis der Interaktion vieler externer Faktoren sogar erhöht (vgl. Pöchhacker 1994a, Kalina 2009, Grbić 2015). Gerade in dieser erweiterten Betrachtungsweise liegt jedoch auch der m.E. vielversprechendste Ansatz zur Beantwortung der Frage nach Dolmetschqualität.
Lange Zeit galt Qualität in der Dolmetschwissenschaft als „that elusive something which everyone recognizes but no one can successfully define“ (AIIC 1982: 1), wobei sich in der Folge zeigen wird, dass der erste Teil dieses Zitates – dass jeder Qualität erkennen könne – nicht unbedingt für alle Beteiligten gleichermaßen gilt. In einem im AIIC-Mitteilungsblatt Communicate! veröffentlichten Artikel fasst Kahane (2000) unter Bezugnahme auf Shlesinger (1997: 123), die Qualität als „an elusive concept, if ever there was one“ bezeichnet hatte, die Problematik treffend zusammen:
The amazing thing is that there is no such consensus. Granted, users and interpreters agree on certain quality criteria, but significant differences remain as to nuances, and especially as to the very essence of the elusive concept of quality; quality for whom, assessed in what manner? (Kahane 2000: 1)
Pöchhacker (2013: 34) hält dagegen, dass Qualität weniger „elusive“ als vielmehr komplex und mehrdimensional sei und daher naturgemäß mehr als eine Definition zulasse. Grbić bezeichnet Qualität als „fuzzy concept“, das aufgrund der zahlreichen unabhängigen Variablen nur schwer exakt zu definieren sei (Grbić 2008: 238). Die Sichtweise von Qualität als komplexes Zusammenspiel verschiedener Faktoren wird u.a. auch von Collados Aís et al. (2007, 2011) und Kalina (2004, 2005, 2009) vertreten. Damit stellt sich die Frage nach den Kriterien und der Perspektive, die einer solchen Definition zugrunde liegen sollen, die bereits Shlesinger (1997: 123) stellt: „Quality according to what criteria? Quality for whom?“ Diese Frage ist allerdings nicht auf den Bereich der Dolmetschwissenschaft beschränkt, sondern stellt sich auch im Zusammenhang mit anderen Dienstleistungen. Im nächsten Abschnitt wird daher zunächst besprochen, aus wessen Sicht Qualität definiert werden kann oder soll, bevor in 2.1.2 auf Definitionen und Qualitätskriterien und in 2.1.3 auf deren Operationalisierung eingegangen wird.
2.1.1 Qualität für wen?
DolmetscherInnen und DolmetschnutzerInnen haben oft unterschiedliche Vorstellungen von Qualität (siehe 3.2.1), weshalb sich beim Versuch, diese zu definieren, die Frage stellt, wer bestimmen soll, was Qualität ist. Sind es die DolmetscherInnen als ExpertInnen, aber eben auch DienstleisterInnen? Oder sind es die RezipientInnen des Zieltextes (ZT) als NutzerInnen bzw. KundInnen, die RednerInnen, deren Ausgangstext (AT) verdolmetscht wird und die somit auch KundInnen sind, oder gar KonferenzveranstalterInnen als eigentliche AuftraggeberInnen? Darüber herrscht bei weitem keine Einigkeit. Chiaro & Nocella (2004) stellen fest:
… there appears to be little harmony concerning which perspective to take when undertaking research: whether it is best to explore the success of an interpretation from the perspective of the interpreter or from that of the user is a debateable issue. Ideally, of course, both standpoints should be considered simultaneously … (Chiaro & Nocella 2004: 279)
Wie einleitend erwähnt ist die Schwierigkeit der Definition des Qualitätsbegriffes nicht auf die Translationswissenschaft beschränkt; auch in vielen anderen Bereichen – vor allem im Dienstleistungssektor – gibt es kein allgemein akzeptiertes Qualitätsverständnis, wie Bruhn (2016: 29) feststellt. Bei Dienstleistungen gibt es dabei laut Bruhn (2016: 29f.) zwei zentrale Ansätze, nämlich den produkt- und den kundenbezogenen Qualitätsbegriff. Beim produktbezogenen Qualitätsbegriff steht die Qualität als Summe oder Niveau vorhandener Eigenschaften im Vordergrund, wobei Bruhn diese Kriterien als objektiv bezeichnet aber auch einräumt, dass diese Kriterien im Dienstleistungsbereich schwer beobachtbar sind. Der kundenbezogene Qualitätsbegriff hingegen bezieht sich auf die „Wahrnehmung der Produkteigenschaften bzw. Leistungen durch den Kunden“ (Bruhn 2016: 29), was bedeutet, dass hier keine rein objektive, sondern vielmehr eine weitgehend subjektive Bewertung der aus KundInnenperspektive wichtigen Qualitätsmerkmale stattfindet. Die Anforderungen aus Kundensicht können sich dabei auf Potenzial, Prozess und Ergebnis der Dienstleistung beziehen. (Bruhn 2016: 30) Bei der Dienstleistung Dolmetschung könnten sich die Erwartungen beispielsweise auf verfügbare Sprachen und Dolmetschtechnik (Potenzial), angenehme und flüssige Vortragsweise, Akzent, inhaltlich korrekte und gut verständliche Dolmetschung (Prozess) sowie geglückte Kommunikation (Ergebnis) beziehen (für weitere Erwartungen von NutzerInnen siehe 3.2.1).
Zu Problemen kommt es vor allem dann, wenn die beiden Perspektiven stark auseinandergehen (Bruhn 2016: 29f.). Allerdings macht Bruhn (2016: 30) auch darauf aufmerksam, dass trotz der Bedeutung, die die KundInnenperspektive im Dienstleistungsbereich hat, die Qualitätskriterien nicht einseitig aus KundInnensicht festgelegt werden dürfen, sondern auch die Unternehmensperspektive berücksichtigt werden muss.
Bruhn spricht sich daher für eine Kombination der beiden aus und definiert den Begriff der Dienstleistungsqualität wie folgt:
Dienstleistungsqualität ist die Fähigkeit eines Anbieters, die Beschaffenheit einer primär intangiblen und der Kundenbeteiligung bedürfenden Leistung gemäß den Kundenerwartungen auf einem bestimmten Anforderungsniveau zu erstellen. Sie bestimmt sich aus der Summe der Eigenschaften bzw. Merkmale der Dienstleistung, bestimmten Anforderungen gerecht zu werden. (Bruhn 2016: 32)
Ein absoluter Qualitätsbegriff, der Qualität als Maß der Güte einer Leistung angibt (Bruhn 2016: 30), sei im Dienstleistungssektor nicht zielführend, da die Erwartungen an das Leistungsniveau aus Sicht des Leistungsempfängers, also der KundIn, festgelegt werden, womit subjektive und auch relative Einzelanforderungen ins Spiel kommen; vielmehr sei bei der Messung der Dienstleistungsqualität die Verknüpfung der beiden Qualitätsperspektiven sinnvoll (Bruhn 2016: 32). Schließlich nützt es wenig, wenn die Dienstleistung aus DienstleisterInnensicht von hoher Qualität ist, wenn die KundInnen dies nicht so sehen. (Bruhn 2016: 30ff.) Die wahrgenommene Dienstleistungsqualität wird durch die Erwartungen an die Dienstleistung einerseits und die gelieferte und wahrgenommene Dienstleistung andererseits bestimmt, wobei die Wahrnehmung individuell unterschiedlich sein kann (Bruhn 2016: 34).
Auf