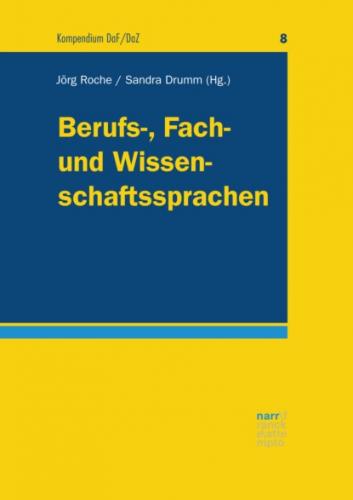Die kognitive Linguistik, die Psycholinguistik, die Neurolinguistik, die kognitiv ausgerichteten Kulturwissenschaften sind also Bezugsdisziplinen, die als Grundlage einer kognitiv ausgerichteten Sprachdidaktik fungieren. Sie sollen in den Bänden dieser Reihe soweit zum Tragen kommen, wie das nur möglich ist. Bei jedem Band stehen daher die Prozesse in den Köpfen der Lerner im Mittelpunkt der Betrachtung.
1 Grundlagen der Forschung an Fachsprachen
Die Fachsprachenforschung ist einer der Kernbereiche angewandter Linguistik mit Beziehungen zu den Arbeitsfeldern Sprachenlehren und -lernen, Sprachdidaktik, aber auch der Analyse von Wirtschafts-, Verwaltungs- und technischer Kommunikation. Ihr Ziel ist es, die fachliche Kommunikation zu definieren und ihre Ausprägungen zu verstehen. Des Weiteren gewinnt die Vermittlung von Fachsprachen im Zuge von Internationalisierung der Studienbedingungen an Relevanz. Immer mehr Menschen studieren und lehren im Ausland oder bereiten sich beruflich auf einen Auslandsaufenthalt vor. Dies erfordert Sprachkenntnisse, die über alltagssprachliche Kompetenzen hinausgehen, und rückt die Vermittlung von Fachsprachen in den Fokus. Aber was sind Fachsprachen, und was unterscheidet sie von dem, was normalerweise im fremdsprachlichen Unterricht behandelt wird? Welche Kompetenzen benötigen Lerner, wenn sie Fachsprachen lernen, und wovon sind diese Kompetenzen abhängig? Diese Fragen lassen sich nicht ohne einen Bezug zu dem beantworten, was das Fach ausmacht – die Gegenstände, die im Fach behandelt werden, die Mittel und Werkzeuge, mit denen diese Gegenstände bearbeitet werden und schließlich die Personen, die die fachlichen Gegenstände bearbeiten: Fachleute sowie Experten und Expertinnen.
Die Betrachtung von Fachsprachen erfolgt im Fortgang dieses Modules daher aus unterschiedlichen Perspektiven. Zunächst werden die grundlegenden Begriffe geklärt. Anschließend werden die sprachlichen Mittel, die für Fachsprachen typisch sind, bezogen auf ihre pragmatische Funktion beschrieben. Bei der Klassifikation von Fachsprachen spielen die Gegenstände und Akteure der fachsprachlichen Kommunikation eine entscheidende Rolle. Im weiteren Verlauf wird Fachsprache auf dieser Basis in Subsprachen differenziert und als Varietät, Register und Genre dargestellt. Dabei wird jeweils einbezogen, welche Konsequenzen sich aus dem Besprochenen für die Konzeption fach- und berufssprachlichen Unterrichts ergeben.
In jüngerer Zeit macht sich besonders die Ausrichtung auf gebrauchsorientierten Unterricht für berufliche Zwecke im deutschen Schulsystem stark bemerkbar. Hier gibt es verschiedene groß angelegte Initiativen, deren Ergebnisse aber in sehr unterschiedlichem Maße in den Schulsystemen der Länder umgesetzt werden. Zu nennen sind hier unter anderem das Projekt FörMig (Ohm, Kuhn & Funk 2007), die Arbeiten zu mehrsprachigen Curricula (Hufeisen 2011; siehe auch das Projekt PlurCur! Allgäuer-Hackl, Brogan, Henning, Hufeisen & Schlabach 2015) und das Bayerische Modell (Roche & Terrasi-Haufe im Druck), dessen heutige Tragweite in vielen Schulsystemen in Deutschland im Kontext der Beschulung und Ausbildung von Flüchtlingen auf die grundlegenden Arbeiten an einem nicht-segregativen, handlungsorientierten berufssprachlichen Unterricht fußt. Das Prinzip der vollständigen Handlung (Riedl & Schelten 2013) ist dabei gut vereinbar mit den entsprechenden Prinzipien der Berufsschulpädagogik und wird umgesetzt im Unterrichtsprinzip Berufssprache Deutsch (siehe Lerneinheit 8.1).
1.1 Pragmatik der fachsprachlichen Kommunikation
Sandra Drumm
Sprache ist mehr als nur die neutrale Übermittlung von Inhalten. Dieses Phänomen kennen wir aus der Alltagssprache, wenn beispielsweise zwischen den Zeilen gehörte Inhalte für Missverständnisse sorgen, aber auch aus interkulturellen Zusammenhängen: Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen verstehen Worte unter Umständen anders als wir, da sie andere Konzepte damit verbinden. Denken Sie beispielsweise an eine Fahrt mit dem Bus. Sie verbinden damit ganz bestimmte Vorstellungen, vielleicht haben Sie sofort das Design der Fahrzeuge Ihres örtlichen Verkehrsverbundes im Sinn. Denken Sie nun an eine Busfahrt in Indien. Verändert sich die Vorstellung? Wahrscheinlich ergibt sich nun ein ganz anderes Bild von den Konzepten, die mit Bus und Fahrt ausgedrückt werden. Sprache ist also nicht neutral. Doch gilt das auch für die Fachsprachen? Und wenn nein, was für Konzepte sind dann mit Fachsprachen verbunden? Welche Kennzeichen besitzen Fachsprachen und wie sind diese mit den Zwecken von fachlicher Kommunikation verbunden? Diesen Fragen wollen wir im Folgenden nachgehen.
Lernziele
In dieser Lerneinheit möchten wir erreichen, dass Sie
Fachsprache als sprachliche Handlung unter Fachleuten kennen und einschätzen können;
sprachliche Spezifika fachsprachlicher Kommunikation kennen und verstehen können;
fachsprachlichen Unterricht in der Fremdsprache begründen können;
Ableitungen von Fachsprache als sprachliches Handlungssystem auf die Gestaltung von Unterricht treffen und begründen können.
Experiment
Nun wollen wir uns zunächst ansehen, welche Spezifika fachliche Kommunikation aufweist, ehe wir diese auf deren Funktion beziehen. Der folgende Text ist sofort als fachsprachlich zu erkennen, selbst wenn wir nur Teile davon verstehen. Unterstreichen Sie, was Sie an diesem Textausschnitt als typisch fachsprachlich empfinden und überlegen Sie, welchem Fach der Textausschnitt wohl zugeordnet werden kann. Begründen Sie Ihre Überlegungen.
Zwei miteinander kämmende Zahnflanken haben im Berührungspunkt A die gemeinsame Tangente TT und die gemeinsame Normale NN. Man nennt den Punkt C der auf der Verbindungslinie der beiden Radmittelpunkte O1 und O2 und auf der Normalen NN im Berührungspunkt der Zahnflanken liegt, den Wälzpunkt. Gleichförmiges Übersetzungsverhältnis ist nur dann gewährleistet …
(Beispiel aus Buhlmann & Fearns 2000: 39)
1.1.1 Spezifika der fachsprachlichen Kommunikation
An diesem kurzen Textabschnitt lassen sich bereits mehrere, für Fachsprachen typische Elemente identifizieren. Begriffe wie Zahnflanken und Wälzpunkt sind auf den ersten Blick als Fachbegriffe identifizierbar – besonders wenn der Leser oder die Leserin keine Vorstellung damit verbinden kann. O1 und O2 sowie NN stellen Abkürzungen dar, die Bilder von mathematischen Gleichungen und Formeln entstehen lassen, was den Text in die Nähe naturwissenschaftlich-technischer Fachsprachen rückt. Auch dass alltagssprachliche Wörter wie kämmende hier in fachspezifischer Bedeutung auftreten, wird schnell deutlich. Damit sind die auffälligsten Phänomene der Fachsprache bereits aufgezählt: Ein spezifisch fachlicher Wortschatz,