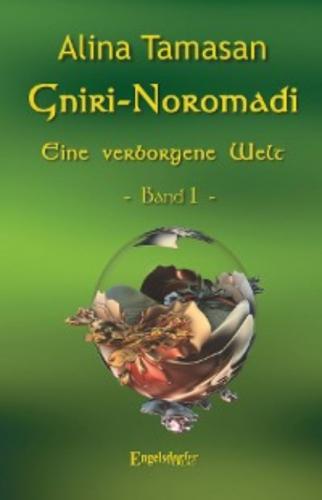„Glaube mir, es geht schneller als du denkst“, sagte die Heilerin und legte ihre Hand auf Finilyas Bauch. Irukye, die dabei stand, nickte.
„Sie hat recht“, sagte die alte Frau. „Wenn das Kleine da ist, musst du es lange tragen, bevor es alleine läuft. Es wird zwar bald kräftig werden, aber auch nicht so schnell.“ Finilya sah ihre Mutter an. Tränen standen der alten Gniri in den Augen, sogar Rìa schaute betrübt drein.
„Pass auf dich auf, mein Kleines“, sagte er und tätschelte seiner Tochter die Wange, „und du auch, hüte sie! Sie ist noch jung, sie braucht dich“, wandte er sich an Rangiolf. Der nickte. Dann blickte er zu seinen Eltern hinüber und wurde selbst traurig. Zeit seines Lebens hatte er sich vor seiner Mutter Yhsa gefürchtet und Gabra für einen albernen alten Mann gehalten, nun vermisste er beide jetzt schon! Er verabschiedete sich von seinen Eltern und den Geschwistern mit einer innigen Umarmung.
„Viel Glück!“, sagte sein Bruder Brafar und drückte ihn an seine Brust. „Pass auf dich auf! Die Welt da draußen, die ist irgendwie … krank.“
„Wird schon gut gehen“, meinte Rangiolf. Finilyas Schwester Mèfai hielt Pindra hoch, damit Finilya ihn noch einmal küssen konnte.
„Pass gut auf ihn auf“, sagte die zu ihrer Schwester. „Er braucht dich, nun bist du die Älteste!“ Pythera sah dem Abschied zu. Ab und an wanderte ihr Blick suchend über den Himmel, Retasso wusste warum.
„Kommt sie?“, fragte er.
„Ja“, antwortete die Heilerin und zeigte auf einen Punkt, der von Weitem wie eine Wolke aussah. „Da!“ Der Punkt näherte sich und brachte einen kräftigen Windstoß mit, der den Anwesenden das Haar zerzauste. Viele hatten in ihrem ganzen Leben noch nie eine Ràktsia gesehen und so war deren Ankunft für sie ein besonderer Moment.
„Ich glaube“, hauchte Hiara während der Landung und formte aus ihrem Wolkenkörper eine den Waldbewohnern ähnelnde Gestalt, „das ist meine erste Ankunft auf den Gefilden der Erde seit …“, ihre runden silbernen Augen bekamen einen nachdenklichen Zug. Dann sah sie Rangiolf. „Guten Abend, mein Freund!“, lächelte sie und gab ihm ihre zarte weiche Hand. „Finde dich selbst und finde die Menschen, dann kehre wieder.“ Sie überreichte ihm ein Säckchen mit Heilsteinen. Der Gniri verbeugte sich und nickte. Er verwahrte Hiaras Worte wohl in seinem Herzen. Nun wandte sich Hiara an Finilya.
„Es wird kräftig und gesund“, sie legte ihre Hand auf den Bauch, „genau wie du!“
„Was ist es denn? Mädchen oder Junge?“, fragte die junge Frau zaghaft.
„Was fühlst du?“ Hiara sah sie aufmerksam an.
„Ich denke, ein Mädchen.“
„So ist es!“ Noch ehe Finilya etwas erwidern konnte, wandte sich Hiara an Retasso. „Nicht alles erfüllt sich, wie du es erwartest.“ Nun sprach sie zur Heilerin. „Meine liebe Freundin, wir kennen uns schon sehr lange.“ Pytheras Miene wurde melancholisch. „Löse dich vom Kummer der Vergangenheit und Neues wird dir zustreben.“ Sie blickte zu Retasso, die Heilerin verstand. „Vertraue auf deine innere Führung und lass dich nicht zermürben, gehe deinen Weg. Hilfe wird kommen, wenn du es am wenigsten erwartest.“ Dann legte sie ihre Hände nacheinander auf die Köpfe der Anwesenden und entließ sie mit ihrem Segen in den Schutz der Dunkelheit.
In der Psychiatrie (Giri-ù thra-ha)
Ihre Eltern waren nicht zu Hause, und das war auch gut so. Keiner sollte sie in diesem aufgelösten Zustand sehen, das würde nur unangenehme Fragen nach sich ziehen. – Im Frühjahr war sie 20 geworden, sie hatte das Abitur in der Tasche und wartete auf einen Studienplatz in Biologie, also war sie eine gute Tochter. Oder?
Noromadi saß auf dem Bett und sah in den Spiegel gegenüber. Große schwarze Augen blickten sie aus einem kleinen runden Gesicht mit hohen Wangenknochen an. Ihre Haut war dunkel, das pechschwarze Haar fiel in dicken, widerspenstigen Locken über ihre schmalen Schultern. Manchmal, so schien es ihr, fühlte sich ihr Schopf an, als bestünde er aus lauter Borsten, die sich kaum bändigen ließen. Sie sah auf ihre Hände, die klein und schmal waren wie sie selbst, aber auch irgendwie spitz, fand sie – fast wie Pinzetten. Noromadi fand ihr Aussehen unnatürlich, einfach nicht normal!
Sie zweifelte an sich und fragte sich zum wiederholten Mal, wie so jemand wie sie, die Tochter dieser Eltern sein konnte? Ihr Vater war großgewachsen und blond, ihre Mutter etwas kleiner, sie hatte hellbraunes, leicht rötlich schimmerndes Haar. Es waren ganz normale ehrbare Menschen mit einem gut bezahlten Job, einem Eigenheim und kleinen Garten. Was also hatte jemand wie sie bei solchen Menschen zu suchen? Tränen sammelten sich langsam in ihren dunklen Augen.
„Ich muss es jemandem erzählen“, flüsterte sie mit heiserer Stimme, „sonst platze ich! Aber wem? Wem soll ich es sagen? Nicht, dass sie mich wieder in die Psychiatrie stecken, wie damals, als ich mich umbringen wollte. Dabei hatte ich doch nur diesen Engel gesehen, der war so wunderschön. Ich wollte zu ihm, fort von diesem schrecklichen Ort auf der Erde, fort von diesen normalen Menschen …“ Die junge Frau stockte und rieb sich aufgeregt die kleinen, spitzen Hände. „Noromadi, lass den Unsinn, du musst zur Vernunft kommen“, ermahnte sie sich. Sie wischte sich die Tränen von den Wangen und dachte angestrengt nach. „Martin! Martin wird mich verstehen. Er ist doch mein Freund. Er liebt mich. Er wird mir zuhören und mich in den Arm nehmen, mich unterstützen … – Halt, stopp! Ist Martin wirklich der richtige?“ Martin war seit zwei Jahren ihr Partner: ein großer schlanker Mann mit dunkelbraunem kurzem Haar und wachen grauen Augen. Er studierte Informatik und war auf gewisse Weise brillant! Binnen kürzester Zeit konnte sein scharfer Verstand eine Fülle komplexer Zusammenhänge erfassen und zusammenfügen. Ein waschechter Naturwissenschaftler eben. In seiner Welt gab es nichts, was nicht logisch erklärbar wäre. Alles, was er erlebte, konnte er beweisen und begründen. Noromadi sah bei sich das Problem, weil sie das nicht konnte.
„Nicht mit dem, was ich erlebt habe. Das ist einfach nicht begründbar, nicht beweisbar, außer mir, sieht es ja keiner“, schluchzte sie. Trotzdem erhob sie sich, wankte zitternd zum Telefon und wählte Martins Nummer. Am anderen Ende klingelte es: ein Mal, zwei Mal … die junge Frau spürte, wie ihr das Herz bis in den Hals klopfte.
‚Er ist bestimmt nicht zu Hause‘, dachte sie und wollte schon auflegen, als sich Martin meldete.
„Hallo Schatz“, hörte sie ihn sagen, „ich bin gerade zur Türe rein und wollte dich anrufen, ob du Lust hast, mit mir einen Kaffee zu trinken. Es ist so herrliches Wetter.“ Die kleine Frau strich sich nervös eine Haarsträhne aus dem Gesicht und schluckte die Verzweiflung hinunter.
„Das ist schön“, bemühte sie sich, in einem heiteren Ton zu antworten, „der Sommeranfang lässt grüßen!“ Eigentlich hatte sie gar keine Lust, ihr Thema mit ihm an einem öffentlichen Ort zu besprechen. Andererseits, wo sollten sie hin? Hier, in ihrem Zimmer, wollte sie nicht reden, und die kleine Studentenbude, in der er wohnte, schien ihr auch nicht geeignet zu sein. Wenn sie es recht bedachte, gab es für solche Gespräche überhaupt keinen rechten Ort – und auch keine rechte Zeit.
‚Vielleicht beruhige ich mich auf dem Weg, dann behalte ich es einfach für mich‘, schoss es ihr durch den Kopf, ehe Martin sie aus den Gedanken rief.
„Also! Möchtest du?“, hörte sie ihn ungeduldig nachhaken.
„Ähm … ja, gerne.“
„Dann treffen wir uns in einer halben Stunde in unserem Lieblingscafé. Ich spendier dir auch ein Eis, wenn du möchtest.“
„Ja, gerne … bis dann“, antwortete sie und legte auf.
‚Noromadi, du dummes Ding‘, schimpfte sie sich, ‚du musst den Mund halten. Diese Dinge sind nicht für seine Ohren bestimmt. Er wird dich für verrückt halten. – Aber irgendwem muss ich es doch erzählen.‘