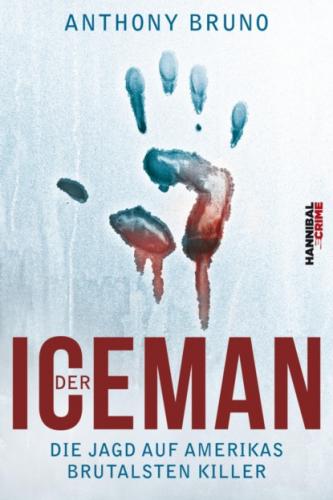Andere drängten sich hinzu, um kostenlos ein paar Scheinchen zu ergattern. Dominick bemerkte, dass DePrima allein war, und beschloss, die allgemeine Ablenkung auszunutzen.
»Na, Lenny, wie läuft’s?« Er stützte sich mit einer Hand gegen die Wand, so dass DePrima keine Möglichkeit hatte, ihm auszuweichen.
»Hallo, Dom, che se dice?« DePrima tat, als habe er ihn gerade erst bemerkt.
Dominick warf ihm einen giftigen Blick zu.
DePrima zuckte die Schultern. »Was soll ich machen?«, meinte er leise. »Ich tue, was ich kann.«
»Wann, Lenny? Wann?«
»Ich versuch’s ja, Dom. Ich probiere es andauernd. Wie gesagt, ich habe ihn schon angerufen und ihm erzählt, ich hätte hier jemanden, der größere Mengen Waffen kaufen möchte. Ich hab angeboten, ein Treffen zu arrangieren. Aber er beißt einfach nicht an.«
»Warum nicht?«
»Du verstehst das nicht, Dom. Es ist klüger, den Polacken nicht zu bedrängen. Es sei denn, du bist scharf auf mächtig viel Zoff.«
»Hast du ihm erzählt, dass ich okay bin?«
»Natürlich, was glaubst denn du? Ich hab ihm gesagt, wir hätten schon einige Geschäfte miteinander gemacht, und mich für dich verbürgt, Dom. Ich schwör’s.«
»Hast du ihm gesteckt, ich hätte Mafia-Verbindungen?«
»Klar.«
»Hast du ihm erklärt, dass ich einen Kunden habe, der eine große Bestellung aufgeben will? Eine wirklich große Bestellung?«
DePrima nickte.
»Verfluchte Scheiße, Lenny, warum rührt sich dieser Kerl denn dann nicht?«
»Wie schon gesagt, Dom, der Polacke lässt sich nicht drängen. Er entscheidet, ob er was tut und wann, und es ist besser, keine Fragen zu stellen.«
Dominick blickte zum Pokertisch. Kipner warf mit seinen Fünfern um sich, als ob es Konfetti wäre. Alle hatten ihren Spaß daran, besonders der zwielichtige Bulle. Er wandte sich wieder zu DePrima. »Ich glaube, du hältst mich bloß hin, Lenny. Du hast mich seit dem ersten Tag angeschissen. Dein ganzes Gerede ist ein einziger Schwindel. Du bist ein mieser Angeber. Ich werde die ganze Sache sausen lassen, und dann wollen wir mal sehen, wie es dir bei …«
Das Münztelefon klingelte. DePrima griff nach dem Hörer. »Eine Sekunde, Dom, beruhig dich, ja?«
Wenn er nicht seine Tarnung wahren müsste, hätte Dominick dem kleinen Mistkerl diesen gottverdammten Hörer in die Kehle gestopft.
»Hey, wie geht’s?« DePrima machte ihm heftige Zeichen und deutete zum Telefon. »Du meinst Dominick Provenzano? Ja, er kommt immer noch hier vorbei. Warum?«
Dominick musterte ihn finster. Was sollte diese Scheiße? Erwartete DePrima tatsächlich, er könne ihm weismachen, Kuklinski sei am Apparat?
»Na ja, er hat mir erzählt, er könnte alles kriegen, was so zu haben ist, Rich.« DePrima schaute ein wenig unsicher zu ihm. »Bestimmt, keine Sorge. Ich kenne Leute, die schon was mit ihm gemacht haben. Er ist zuverlässig.«
Wenn das am Telefon wirklich Kuklinski war – und Dominick war keineswegs davon überzeugt –, knabberte der Fisch nun endlich am Köder. Er wartete und lauschte. Mehr konnte er im Moment nicht tun. Jetzt lag alles am Fisch selbst.
»Also, Rich, ich kann dir nur sagen, dass er bei mir immer korrekt war. Wir haben hin und wieder gutes Geld zusammen gemacht, und das ist alles, was mich kümmert. Willst du dich mit ihm treffen, dann mach das, oder willst du erst ein amtliches Führungszeugnis?«
Dominick trommelte ungeduldig mit den Fingern gegen die Wand.
DePrima schüttelte den Kopf. »Kann ich dir nicht sagen, Rich. Er behauptet, er kann alles beschaffen. Keine Ahnung, ob’s stimmt oder nicht. Er ist übrigens gerade hier. Warum fragst du ihn nicht selbst?«
Dominick warf ihm einen bösen Blick zu. Wenn das irgendein idiotischer Trick war, würde DePrima es noch bereuen.
»Also, das liegt an dir, Rich. Ganz wie du willst … genau … okay, alles klar.«
Er hängte ein.
»Wer war das? Richie, nehme ich an.«
DePrima senkte die Stimme. »Ich schwöre beim Grab meiner Mutter, Dom, dass er es war. Er will dich treffen. Sofort, beim Dunkin’ Donuts drüben am Shop Rite. Er sagt, er brauche etwas, und ich hab ihm erzählt, dass du es ihm besorgen könntest.«
Obwohl er ihm nur zu gern glauben wollte, blieb Dominick misstrauisch. »Und was ist das?«
»Zyankali.«
Eine warme Brise wehte durch das offene Fenster des Shark, als Dominick Polifrone auf der alten Stahlträgerbrücke den Fluss überquerte. Die Sonne spähte durch graue Regenwolken, und am Horizont wurde der Himmel allmählich wieder blau. Obwohl der Regen nachließ, hörte man die Reifen auf dem schwarzen Asphalt zischen. Dominick nahm jedoch nichts davon wahr. Er dachte nur an Richard Kuklinski und versuchte, sich nicht nervös zu machen, sondern einfach er selbst zu sein. Das war der Schlüssel zum Erfolg als Undercoveragent: Man musste sich ganz normal geben, so wie man war.
Dominick hatte die Erfahrung gemacht, dass kunstvoll ausgearbeitete Lebensläufe und Decknamen leicht problematisch werden konnten. Man durfte nicht zögern, wenn man sich in solcher Gesellschaft herumtrieb. Brauchte man auch nur eine Sekunde, um auf seinen Decknamen zu reagieren, entstand schon der erste Verdacht. Und dabei blieb es selten. Ein Fehler, und es konnte einem übel ergehen – und ein Fehler bei den falschen Leuten kostete einen möglicherweise das Leben.
Deshalb unterschied sich Dominick Polifrone nicht allzu sehr von ›Michael Dominick Provenzano‹. Er hatte im ›Laden‹ erzählt, dass einige Leute ihn als Sonny kannten, aber allen gesagt, sie sollten ihn einfach Dom nennen.
Die Adresse auf seinem Führerschein war ein riesiges Hochhaus in Fort Lee. Dort wohnte er angeblich bei seiner Freundin.
Michael Dominick Provenzano hatte seine Kindheit in einem Arbeiterviertel in Hackensack, New Jersey, verbracht. Genauso war es bei Dominick Polifrone gewesen.
Michael Dominick Provenzano hatte als Kind geklaut, und Dominick Polifrone ebenso.
Aus Dominick Polifrone wäre am Ende vielleicht tatsächlich ein Typ wie Michael Dominick Provenzano geworden, wenn er kein Football-Stipendium der Universität von Nebraska bekommen hätte. Nicht dass Football oder der Mittlere Westen ihm den Kopf zurechtrückte – ganz im Gegenteil. Dominick fiel in Nebraska ein wie ein italienisch-amerikanischer Tornado. Da er aus dem Osten kam, war er bei allem, was gerade in Mode war, den anderen stets voraus. Er trug ausgestellte Hosen mit Schlag auf dem Campus, ehe die Farmerkinder auch nur wussten, dass es so etwas überhaupt gab, und bei jeder Rückkehr aus den Ferien brachte er einen Schwung der neuesten Platten mit, die in Nebraska noch wochenlang nicht in den Läden zu haben sein würden. Schon in Hackensack hatte Dominick ein großes Maul gehabt, aber in Nebraska war er gar nicht mehr zu bändigen. Bis zu seinem zweiten Jahr war es für ihn ein wöchentliches Ritual geworden, an Freitagabenden in Bars zu randalieren, und allmählich gehörte es ebenso zu diesem Ritual, die Nacht im Kittchen zu verbringen. Zu dieser Zeit hatte ein Sergeant der Polizei von Omaha ein besonderes Interesse an diesem jungen Unruhestifter aus New Jersey, der ihm die letzten Nerven raubte, und schleppte ihn zum Campus, um eine kleine Unterredung mit Dominicks Trainer zu führen. Dieses Treffen war es gewesen, das ihm den Kopf zurechtgerückt hatte. Der Sergeant und sein Trainer stellten ihn klipp und klar vor die Alternative: Entweder fang an, dich wie ein zivilisierter Mensch zu benehmen, oder hau endgültig