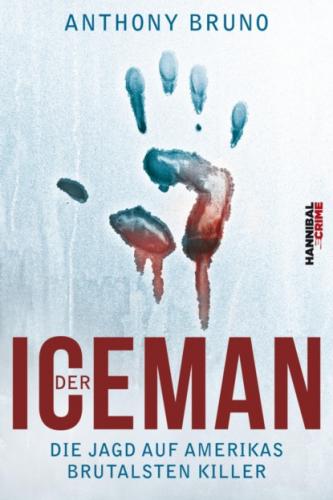Er schlug zwar immer noch ab und zu Krach, spielte weiterhin Football und war ein so ausgezeichneter Boxer, dass er 1969 die Bezirksmeisterschaft um den Goldenen Boxhandschuh im Schwergewicht gewann. Aber seine Einstellung hatte sich verändert. Er wusste jetzt, wer er war, und hatte seinen leichten Hang zum Kriminellen abgestreift. Dominick Polifrone sah sich nun als einer, der auf der richtigen Seite stand.
Genau das war es, was ihn als verdeckten Ermittler so herausragend machte. Er konnte reden wie ein Gauner, aussehen wie einer und sich so benehmen, weil all dies ein Teil von ihm war; aber tief im Innern wusste er, wo er hingehörte.
Daher machte sich Dominick auch keine weiteren Gedanken über seine Tarnung, während er zum Dunkin’ Donuts unterwegs war. Er wusste, dass er überzeugend wirkte. Nur dass er Richard Kuklinski allein und ohne irgendwelche Rückendeckung treffen würde, bereitete ihm leichtes Unbehagen.
So kurzfristig hatte er niemanden mehr vorher informieren können. Angeblich wartete Kuklinski auf ihn, und die Fahrt vom ›Laden‹ zu diesem Doughnut-Shop dauerte fünf Minuten. Wenn er zu lange brauchte, war Kuklinski verschwunden, das stand fest. Der Kerl war über alle Maßen vorsichtig. Beim geringsten Misstrauen würde er Leine ziehen, und Dominick konnte die Hoffnung abschreiben, ihn je wieder zu treffen. Diese erste Begegnung war ganz entscheidend. Innerhalb von fünf Minuten würde er wissen, ob die Sache klappen würde oder nicht. Vor allem kam es darauf an, die Kontrolle zu behalten. Auf keinen Fall durfte er vor ihm kriechen, ganz egal, wie sehr er darauf brannte, an ihn heranzukommen; sonst würde Kuklinski ihn für eine miese kleine Nummer halten und nichts mit ihm zu tun haben wollen. Dominick tastete nach seiner Walther PPK 380 Automatik.
Trotz der milden Temperaturen war er wie immer mit einer Lederjacke bekleidet. Sie war sozusagen Teil seiner Uniform als Undercoveragent und ermöglichte es ihm, unauffällig eine Waffe zu tragen. In Anbetracht von Kuklinskis Ruf hatte er vor, seine Hand in der Tasche und den Finger am Abzug zu halten.
Vermutlich gingen Dutzende von Morden auf Kuklinskis Konto, aber der Polizei war es in keinem einzigen Fall gelungen, ausreichend Beweismaterial zusammenzutragen, um ihn zu verhaften. Dominick hatte das unbestimmte Gefühl, dass die ihnen bekannten Morde in Wirklichkeit nur ein Bruchteil der Taten waren, die Kuklinski verübt hatte. Allem Anschein nach war er auf sämtlichen Gebieten seines mörderischen Handwerks bestens bewandert.
Manchmal tötete Kuklinski allein, manchmal hatte er einen Helfershelfer dabei. Gelegentlich arbeitete er auf Bestellung; ein anderes Mal handelte es sich um eine persönliche Abrechnung. Zuweilen war es eine geschäftliche Angelegenheit, dann wieder blinde Wut. Es war bekannt, dass er kleine Waffen wie eine zweischüssige Derringer benutzt hatte, aber auch große wie eine zwölfkalibrige Flinte. Bei wenigstens zwei Gelegenheiten hatte er mit Handgranaten getötet. Er hatte Baseballschläger verwendet, Kreuzschlüssel, Seile, Drahtschlingen, Messer, Eispickel, Schraubenzieher, falls nötig sogar seine bloßen Hände. Und aus irgendeinem Grund, den niemand so recht erklären konnte, bewahrte er eines seiner Opfer über zwei Jahre lang tiefgefroren auf, ehe er sich die Leiche vom Hals schaffte, was ihm in Kreisen der Polizei von New Jersey den Spitznamen Iceman eintrug. Doch nach Erkenntnissen der State Police war eine der Lieblingsmethoden Kuklinskis die Vergiftung mit Zyankali. Dominick wusste aus seiner sechzehnjährigen Berufserfahrung, dass man niemals irgendeinen Kriminellen leichtfertig unterschätzen durfte, aber jemandem wie Richard Kuklinski war er noch nie zuvor begegnet. Er war kein wahnsinniger Serientäter, der zur Befriedigung eines abartigen sexuellen Verlangens mordete. Manchmal tötete er im Abstand von wenigen Wochen; manchmal dauerte es Jahre, bis er wieder zuschlug. Er rauchte nicht, trank nicht, spielte nicht und war nicht hinter Frauen her. Er passte einfach in kein herkömmliches Schema, und es war unmöglich, ihn zu beschreiben – außer mit dem einen Wort: Monster. Dominick atmete tief durch und nahm seine Hand aus der Tasche.
Vor ihm schaltete eine Ampel auf Rot. Er lenkte den schwarzen Shark rasch auf die linke Spur und hielt hinter einem Streifenwagen. Der Bulle am Steuer warf ihm im Seitenspiegel einen Blick zu. Dominick schaute zum Dunkin’ Donuts, das ein Stück weiter die Straße hinauf auf der anderen Seite der Kreuzung lag. Die verrücktesten Gedanken überkamen ihn plötzlich. Was war, wenn diese beiden Bullen beschlossen, ihn anzuhalten? Er hatte keinen Blinker gesetzt, als er nach links eingebogen war. Was war, wenn er auf die Beschreibung von irgendeinem Arsch passte, nach dem sie zufällig suchten? Dort drüben wartete Kuklinski. Wenn er sah, wie die Bullen ihn befragten, würde er wahrscheinlich abhauen. Schlimmer noch, er würde ihn für einen harmlosen Straßenganoven halten, irgendeinen Wichser, den die Bullen nach Lust und Laune herumschubsen konnten. An solch kleinen Nummern war Kuklinski nicht interessiert, und sicher hätte er sofort bei ihm verspielt. Dominick hatte sich alle erdenkliche Mühe gegeben, ein Image aufzubauen, dass er jemand mit soliden Verbindungen zu den Mafia-Familien in New York war. Nach 17 Monaten harter Arbeit, in denen er sich mit dem miesesten Gesindel angefreundet hatte, wäre es zum Wahnsinnigwerden, wenn seine erste und bisher einzige Chance, endlich den Iceman zu treffen, platzte – und ausgerechnet auf diese Weise.
Der Bulle hinter dem Lenkrad musterte ihn immer noch im Seitenspiegel. Sein Partner drehte sich jetzt ebenfalls um und starrte durch das Sicherheitsgitter, das die Vordersitze vom hinteren Bereich des Streifenwagens trennte.
Dominick biss die Zähne zusammen: Nicht jetzt, Jungs. Bitte, nicht jetzt!
Die Ampel wurde grün. Der Verkehr auf der rechten Spur setzte sich in Bewegung, aber das Polizeiauto rührte sich keinen Millimeter. Der Fahrer beäugte ihn weiterhin. Allmächtiger, nicht jetzt! Dominick blickte zu dem bunten Reklameschild des Dunkin’ Donuts auf der anderen Seite der Kreuzung hinüber.
Bitte!
Er fixierte die Bremslichter des Streifenwagens und überlegte, ob er kurzerhand um ihn herumfahren sollte. Aber womöglich warteten die beiden bloß darauf, um ihn sich genauer anzuschauen, wenn er auf gleicher Höhe war, ehe sie ihn an den Straßenrand winkten. Gottverdammt! Irgendwas musste er tun. Mit dieser Ünschlüssigkeit machte er sich erst recht verdächtig.
Gerade als er sich entschlossen hatte durchzustarten, erloschen plötzlich die Bremslichter, und der Streifenwagen fuhr an. Dominick holte tief Luft, gab Gas und überquerte die Kreuzung. Er setzte den linken Blinker – der Doughnut-Shop war direkt vor ihm.
Nur drei Fahrzeuge standen auf dem kleinen Parkplatz: ein schwarzer Toyota-Kleinlaster mit grellrosa Scheibenwischern, ein beigefarbener VW Rabbit mit eingedellter Stoßstange und ein blauer Chevy Camaro, gute sechs oder sieben Jahre alt. Dominick hielt neben dem Camaro. Nach allem, was er über Kuklinski wusste, war nicht anzunehmen, dass er einen importierten Kompaktwagen fuhr.
Er stellte den Motor ab und schaute nach rechts. Ein großer, kräftig gebauter Mann saß hinter dem Lenkrad und war in eine Zeitung vertieft. Er war kahlköpfig bis auf das längliche graue Haar an den Seiten, das sorgfältig über seine Ohren gekämmt war, und trug einen gepflegten Vollbart, ebenfalls überwiegend grau, aber noch durchsetzt mit dem früheren Aschblond. Eine übergroße Sonnenbrille mit verspiegelten Gläsern verbarg seine Augen. Langsam wandte der Mann den Kopf und schaute zu ihm hinüber. Dominick kannte das Gesicht sehr gut. Auf Dutzenden von Überwachungsfotos hatte er es gesehen. Es war der Iceman.
Er hatte das instinktive Gefühl, nach seiner Waffe greifen zu müssen. Der Iceman musterte ihn kritisch, aber Dominick erwiderte seinen Blick scheinbar völlig unbefangen. Er musste von Anfang an, ehe sie auch nur ein einziges Wort wechselten, dafür sorgen, nicht die Kontrolle zu verlieren. Ließ man einem Typen wie Kuklinski die Oberhand, riskierte man, lebendig gefressen zu werden.
Kuklinski schloss seine Zeitung, faltete sie zusammen und stieg aus dem Wagen. Dominick öffnete die Tür seines Lincolns und stieg ebenfalls aus. Erst jetzt merkte er, wie groß Kuklinski tatsächlich war. Mit seinen 1,83 m war er sich bisher noch nie klein oder auch nur mittelgroß vorgekommen, doch verglichen mit Richard Kuklinski wirkte er direkt schmächtig. In der Personenbeschreibung hieß es zwar: ›1,93 m, 270 Pfund‹, aber darüber las man einfach hinweg. Wenn