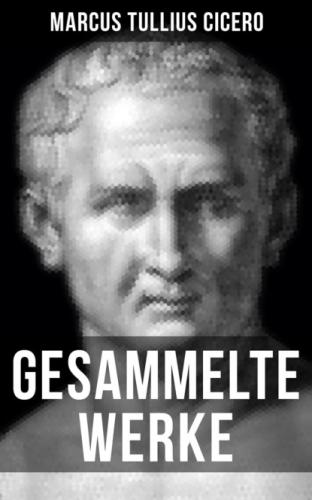Kap. IX. (§ 24.) Jedes lebende Wesen liebt sich selbst und sorgt von seiner Geburt ab für seine Erhaltung. Von der Natur hat es als ersten Trieb zum Schutz seines ganzen Lebens den empfangen, dass es sich selbst erhält, und zwar in dem möglichst besten naturgemässen Zustande. Im Beginn ist es so verworren und unsicher eingerichtet, dass es nur so, wie es beschaffen ist, sich schützen mag, ohne zu wissen, was es ist, was es vermag und wie seine eigene Natur beschaffen ist. Ist es jedoch ein wenig vorgeschritten und beginnt es zu bemerken, wie die einzelnen Dinge es betreffen und sich auf es beziehen, so beginnt es allmählich, sich weiter zu entwickeln, sich kennen zu lernen und einzusehen, weshalb es den erwähnten Trieb habe. Dann beginnt es das seiner Natur Gemässe zu begehren und das Gegentheilige zu verabscheuen. Sonach beruht bei jedem Geschöpfe das Begehren nach bestimmten Dingen darauf, dass diese Dinge seiner Natur angemessen sind, und das höchste Gut besteht daher in einem naturgemässen Leben und in einem möglichst besten und der Natur angemessensten Zustande. (§ 25.) Da nun jedes Geschöpf seine eigenthümliche Natur hat, so muss auch für Alle als Ziel gelten, dass dieser Natur Genüge geleistet werde; denn es steht dem nicht entgegen, dass der Mensch mit den Thieren und diese unter einander etwas Gemeinsames haben, weil die Natur überhaupt Allen gemein ist, vielmehr wird jenes Höchste und Letzte, was wir aufsuchen, nach den verschiedenen Gattungen der Geschöpfe verschieden sein und jede Gattung wird etwas Besonderes, ihr Passendes haben, wie es ihre eigene Natur verlangt. (§ 26.) Wenn ich daher sage, dass für alle lebende Wesen das Höchste in einem naturgemässen Leben bestehe, so darf man dies nicht so verstehn, als wenn für Alle ein und dasselbe als Höchstes gelten solle. Denn schon bei den Künsten lässt sich als etwas ihnen allen Gemeinsames angeben, dass es sich bei ihnen um die Erkenntniss überhaupt handelt, während jede einzelne Kunst auch ihre besondere Wissenschaft verlangt; ebenso haben auch die Geschöpfe ein Gemeinsames in ihrem naturgemässen Leben überhaupt; aber dabei sind doch ihre Naturen selbst verschieden. So ist sie bei dem Pferde eine andere, wie bei dem Ochsen und eine andere bei dem Menschen; aber dennoch haben auch Alle in der Hauptsache eine gemeinsame Natur, und dies gilt selbst über die lebenden Wesen hinaus für alle Dinge, welche die Natur ernährt, vermehrt und beschützt. So sieht man schon bei den Pflanzen, welche aus der Erde hervorsprossen, dass viele sich selbst das bereiten, was zu ihrem Bestehen und Wachsen erforderlich ist, damit sie ihr letztes Ziel erreichen, und deshalb kann man Alles dies zusammenfassen und unzweifelhaft behaupten, dass alle Naturen überhaupt sich selbst erhalten und als Ziel und Höchstes erstreben, sich in dem für ihre Gattung bessten Zustande zu erhalten. Somit kann man sagen, dass alle natürlichen Dinge ein ähnliches, wenn auch nicht genau dasselbe Ziel verfolgen. Hieraus ergiebt sich, dass das höchste Gut für den Menschen in seinem naturgemässen Leben enthalten ist, d.h. in einem Leben, was der durchaus vollkommnen und in Nichts mangelhaften Natur des Menschen entspricht. (§ 27.) Dies habe ich also weiter zu untersuchen, und wenn es etwas ausführlicher und deutlicher geschieht, so werdet Ihr mich entschuldigen; da ich dabei auf das Alter unseres langen Freundes Rücksicht nehmen muss, der dies vielleicht das erste Mal zu hören bekommt. – Ganz recht so, sagte ich, obgleich das, was Du bisher gesprochen hast, für jedes Alter richtig dargelegt sein dürfte. –
Kap. X. Nachdem so, fuhr er fort, das zu erstrebende Ziel von mir auseinandergesetzt worden ist, habe ich nun zu zeigen, weshalb die Sache sich so verhält. Ich beginne deshalb wieder mit dem zuerst aufgestellten Satze, der auch sachlich der erste ist, wonach jedes Geschöpf sich selbst liebt. Wenn dieser Satz auch zweifellos ist, da diese Liebe in jeder Natur steckt und Jeder sie mit seinen Sinnen befasst, so dass kein Widerspruch dagegen zugelassen werden kann, so möchte ich doch, um nichts zu übergehen, einige Gründe dafür anführen. (§ 28.) Wie könnte man wohl einsehen oder denken, dass ein Geschöpf sich selbst hasste; widersprechende Dinge träfen dann zusammen. Denn wenn jenes Begehren der Seele etwas ab sichtlich zu erreichen suchte, was ihm schädlich wäre, weil es sein eigener Feind wäre, so müsste es dies doch seinetwegen thun, und so hasste und liebte es sich zu gleicher Zeit, was unmöglich ist. Wollte ein Geschöpf sein eigener Feind sein, so müsste es die Güter für Uebel und umgekehrt die Uebel für Güter halten und das zu Begehrende fliehen und das zu Verabscheuende begehren, was unzweifelhaft eine Zerstörung des Lebens sein würde. Allerdings kommt es vor, dass Einzelne sich einen Strick oder ein anderes Mittel für den Tod suchen, wie Jener bei Terenz, der »meinte, seinem Sohne so lange weniger Unrecht zuzufügen, als er selbst elend sei«, aber deshalb sind doch solche Menschen nicht als ihre eignen Feinde anzusehn. (§ 29.) Vielmehr treibt Manchen der Schmerz oder die Begierde, Viele auch der Zorn; sie stürzen sich selbst ins Unglück und meinen, damit doch am besten für sich zu sorgen. Deshalb sagt man ohne Zaudern:
»Es ist so einmal meine Gewohnheit; Du handle, wie Du selbst es für nöthig hältst.«
Wenn solche Menschen sich auch selbst den Krieg angekündigt hätten und sich Tag und Nacht kreuzigten und peinigten, so würden sie doch deshalb sich nicht selbst verklagen und zugestehn, dass sie sich selbst in Nachtheil gebracht. Man hört also solche Klagen nur von Denen, die sich selbst lieben und werth schätzen. Wenn man daher von Jemand sagt, dass er schlecht für sich sorge, dass er sein eigner Feind und Verfolger sei und sein Leben verabscheue, so ist immer eine Ursache vorhanden, welche erklärt, dass er dabei doch sich selbst liebt. (§ 30.) Auch genügt es nicht, anzuerkennen, dass Niemand sich selbst hasse, vielmehr muss man auch einsehn, dass Niemandem es gleichgültig ist, in welchem Zustande er sich befinde. Denn sonst würde damit alles Begehren der Seele aufgehoben sein, und so wie wir bei Dingen, die sich in nichts unterscheiden, zu dem Einen nicht mehr neigen, wie zu dem Andern, so würden wir es auch dann für gleichgültig halten, wie wir selbst uns befänden.
Kap. XI. Selbst wenn Jemand behaupten wollte, dass diese Liebe zu sich selbst wesentlich einem andern Gegenstande gelte, den man liebe, und nicht sich selbst, so würde dies durchaus verkehrt sein. Wenn man sich auch in Bezug auf die Freundschaft, auf die Pflichten und die Tugenden so ausdrückt, so weiss man doch, wie es auch gemeint sein mag, was dies heissen solle. In Bezug auf uns selbst aber kann man es nicht einmal verstehn, wenn Jemand sagt, dass er sich selbst wegen eines andern Dinges, z.B. wegen der Lust, liebe; da man vielmehr seiner selbst wegen die Lust liebt, aber nicht sich selbst ihrer wegen. (§ 31.) Denn was ist wohl offenbarer, als dass Jeder sich selbst liebt und zwar in hohem Maasse? Giebt es wohl Einen oder unter wie Vielen Einen, dem nicht bei dem Herannahen des Todes
»die Furcht das Blut aus den Adern treibt