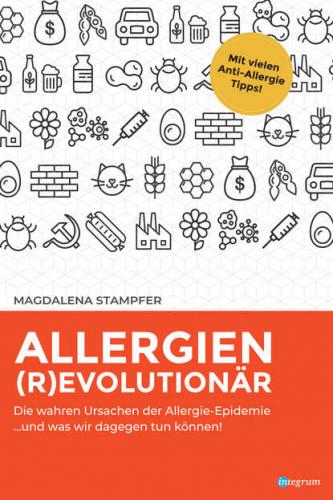Vieles, was Sie in diesem Buch lesen werden, wird dem widersprechen, was Sie bisher über Allergien gelesen oder von Ihrem Arzt gehört haben. Und wenn nicht, dann haben Sie einen tollen Arzt.
Die heutige Definition: Allergie vs. Intoleranz
Im täglichen Sprachgebrauch wird der Begriff Allergie heute zur Bezeichnung einer Reihe von Symptomen herangezogen, bei denen es sich medizinisch gesehen nicht um Allergien handelt, sondern um (mitunter heftige) Unverträglichkeitsreaktionen. Sofern die Allergie nicht so stark ausgeprägt ist, dass ein anaphylaktischer Schock droht, ist die Unterscheidung zwischen Allergie und Unverträglichkeit nicht das Allerwichtigste. Im Alltag will man einfach nur wissen, was man meiden sollte, um sich besser zu fühlen.
Um zu verstehen, was im Hintergrund geschieht, ist es aber wichtig, den Unterschied dieser Begriffe zu kennen. Wie wir aber sehen werden, war die Nomenklatur seit den Anfängen der Allergieforschung alles andere als einheitlich (siehe Abschnitt „Allergie – ein umkämpfter Begriff“).
Grob gesagt unterscheidet sich eine Allergie von einer Intoleranz dadurch, dass bei einer Allergie das Immunsystem beteiligt ist, bei einer Intoleranz jedoch nicht. Beide können ähnliche Symptome hervorrufen, auch wenn dahinter andere Prozesse ablaufen.
Das anerkannte Lehrbuchwissen sagt dazu Folgendes: Bei einer Allergie kommt es zu einer überschießenden Reaktion des Immunsystems. Entweder es sind Immunglobuline beteiligt (vorrangig IgE-Antikörper) oder die Reaktion wird durch bestimmte Entzündungszellen vermittelt. So oder so: Es kommt zu einer Überreaktion des Immunsystems auf einen Fremdstoff. Diese allergieauslösenden Substanzen werden Allergene genannt, es genügt unter Umständen bereits eine geringe Menge davon, um allergische Reaktionen auszulösen. Allergien werden in verschiedene Typen unterteilt (Typ I bis Typ IV), je nach Art der beteiligten Immunglobuline und je nach Zeitpunkt des Auftretens der Symptome (sofort oder verzögert). Eine Erhöhung der IgE-Antikörper im Blut wird als Beweis dafür angesehen, dass eine Allergie vorliegt.
Stellt also das Immunsystem beim Zusammentreffen mit einem Allergen eine vermeintliche Gefahr durch die Substanz fest, bilden sich Antikörper, um dagegen vorgehen zu können. Das Allergen wird als ein schädlicher Eindringling betrachtet und im Immungedächtnis in die Kartei „Angreifen” gesteckt. Hier kommt der nachtragende Charakter der spezifischen Immunabwehr zur Geltung, denn bei erneutem Kontakt mit diesem Stoff wird sofort angegriffen. Histamin wird freigesetzt, die Blutgefäße weiten sich, die Schleimhäute schwellen an. Die Vorgänge zeigen sich dann in den typischen Symptomen einer Allergie: verstopfte Nase, Niesen, tränende Augen, gerötete und juckende Haut. Auch Kopfschmerzen, Verstopfung, Verdauungsbeschwerden, Müdigkeit und noch eine Reihe anderer Symptome können auf eine allergische Reaktion zurückzuführen sein.
Bei einer Intoleranz, auch Pseudoallergie oder Unverträglichkeit genannt, zeigen sich durchaus Symptome, die einer Allergie ähnlich sind, denen aber eine andere Ursache zugrunde liegt. Trotz der mitunter sehr einschränkenden Beschwerden zeigt sich in diesem Fall beim Allergietest kein erhöhter IgE-Wert, denn das Immunsystem ist bei einer Intoleranz nicht auf diese Art und Weise beteiligt. Bei einer Intoleranz kann eine Substanz nicht entsprechend aufgespalten und verwertet werden. Das kann einerseits daran liegen, dass bestimmte Stoffe aufgrund ihrer chemischen Beschaffenheit vom Organismus nicht vertragen werden, was beispielsweise bei Zusatzstoffen der Fall sein kann. Andererseits können Störungen im Darm ebenso zu Unverträglichkeitsreaktionen führen, wenn bestimmte Bakterien und Enzyme fehlen, die für die Verdauung notwendig sind. Ein solcher Enzymmangel ist beispielsweise der Grund für die Unverträglichkeit von Laktose (Milchzucker), Fruktose (Fruchtzucker) oder Histamin. Auch eine psychische Abneigung gegen bestimmte Nahrungsmittel kann eine Rolle spielen. Wer als Kind gezwungen wurde, die Milchsuppe vollständig auszulöffeln, kann sie mitunter für den Rest seines Lebens nicht mehr ausstehen.
Trotz der unterschiedlichen Prozesse im Hintergrund fühlt sich eine Intoleranz oder Pseudoallergie für den Patienten oft nicht viel anders an als eine echte Allergie. In beiden Fällen kommt man um eine genaue Berücksichtigung des Darms nicht herum, denn dort sitzt nicht nur der Großteil des Verdauungstraktes, sondern auch des Immunsystems.
Ob man nun an einer Allergie leidet, die schulmedizinisch erwiesen ist oder an einer, die nicht in das konventionelle Schema passt – der Weg Richtung Beschwerdefreiheit ist ähnlich, was im zweiten Teil des Buches eingehend beschrieben wird. Dreh- und Angelpunkt ist der Darm und eine Vermeidung jener Faktoren, die ihn schädigen. Ob sie nun biochemischer oder psychischer Natur sind, wird von Person zu Person variieren.
Wie die Schulmedizin Allergien betrachtet
Die Schulmedizin sieht die Ursache von Allergien meist darin, dass das Immunsystem überreagiert, und zwar im Grunde einfach so (shit happens). Zwar werden genetische Faktoren und ganz allgemein Umwelteinflüsse als Auslöser genannt, doch im Prinzip kann man nichts dagegen machen. Man hat sich zwar sehr wohl Gedanken darübergemacht, was der tiefere Sinn der Allergien sein könnte. Doch die offiziellen Erklärungsversuche, warum das Immunsystem so aus den Fugen gerät, basieren meist auf folgender Annahme: Dem Immunsystem ist langweilig. Während es früher mit Würmern zu kämpfen hatte, ist es ohne Parasiten derartiger Langeweile ausgesetzt, dass es stattdessen etwas anderes angreift, beispielsweise Weizenproteine aus dem Frühstückscroissant.
In eine ähnliche Kerbe schlägt die Hygiene-Hypothese, die die übertrieben hygienischen Verhältnisse unserer zivilisierten Welt für das verstärkte Aufkommen von Allergien verantwortlich macht. Früher hätten Schmutz und häufiger auftretende Kinderkrankheiten das Immunsystem ausreichend beschäftigt, sodass es nicht auf blöde Gedanken gekommen ist. Ohne diese Spielkameraden wird es trotzig und reagiert allergisch.
Die Behandlung zielt hauptsächlich auf die Linderung der Symptome ab und beschäftigt sich wenig bis gar nicht damit, wie es zur Allergie überhaupt gekommen ist (shit happens because it happens!). Wenn das Meiden der Allergene nicht möglich ist oder die Symptome akut sehr belastend sind, werden Antihistaminika, Cortisonpräparate oder Mastzellenstabilisatoren verschrieben.
Durch Einsatz dieser Mittel verschwindet die Allergie zwar nicht, aber es juckt nicht mehr so schlimm oder die Nase ist wieder frei, das Atmen geht leichter und die Haut schaut besser aus. Cortison hemmt das Immunsystem bei der Arbeit, was bei einem überreagierenden Abwehrsystem zunächst logisch erscheint: Es beruhigt sich, die Entzündung geht zurück. Aber das stellt keine echte Beruhigung dar, eher eine Unterdrückung, die damit zu vergleichen ist, dass man einem aufgebrachten Kind das Weinen verbietet oder bei einer Alarmanlage Ton- und Lichtsignale einfach abschaltet. Es ist dann zwar rundherum alles still, aber das eigentliche Problem wurde nicht behoben.
Langfristig gesehen ist die Unterdrückung des Immunsystems keine besonders gute Idee. Und auch der äußerliche Einsatz von Cortison hat häufig eine Schwächung und Schädigung der Haut zufolge. Man braucht sich nur den Beipackzettel von Cortisonpräparaten durchzulesen, um einen Eindruck davon zu bekommen, was diese im Körper alles anstellen können (siehe Kasten). Hier am Beispiel von Decortin® H der Firma Merck. Die Auswahl dieser Firma ist wirklich rein zufällig. Die Beipackzettel anderer Cortisonpräparate unterscheiden sich in dieser Hinsicht kaum und sind auch nicht lustiger zu lesen.
Aus dem Beipackzettel von Decortin® H (Wirkstoff: Prednisolon)
Infektionen und parasitäre Erkrankungen: Maskierung von Infektionen, Auftreten, Wiederauftreten und Verschlimmerung von Virus-, Pilz-, Bakterieninfektionen, sowie von parasitären oder opportunistischen Infektionen, Aktivierung einer Zwergfadenwurminfektion Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems: Blutbildveränderungen (Vermehrung der weißen Blutkörperchen der aller Blutzellen, Verminderung bestimmter weißer Blutkörperchen) Erkrankungen des Immunsystems: Überempfindlichkeitsreaktionen (z.B. Arzneimittelhautausschlag),