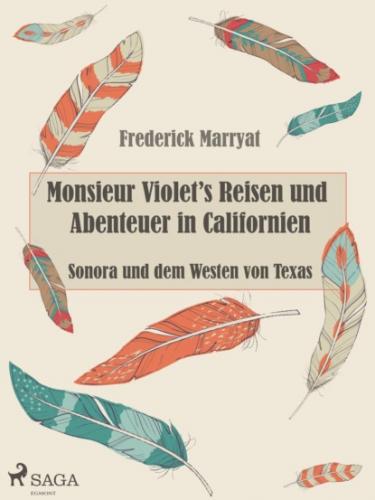Endlich war der Winter vorüber, und mit den ersten Wochen des Frühlings erneuerte sich unsere Hoffnung auf Rettung. Die Arrapahoes liessen in ihrer Wachsamkeit nach und boten uns sogar an, wir sollten sie auf einem Ausfluge nach dem Osten begleiten. Wir gingen natürlich mit Freuden darauf ein und gelangten so in die schönen Prairieen von Nord-Sonora. Das Glück begünstigte uns. Die Arrapahoes verfolgten eines Tages eine Spur von Apaches und Mexikanern, um sie zu überraschen und zu tödten, fielen aber in eine Schlinge, so dass ihrer Viele zu Grunde gingen.
Wir trugen kein Bedenken, unsere bisherigen Herren zu verlassen, sondern spornten unsere rüstigen Rosse und fanden bald, dass unsere Befreier eine Abtheilung von Beamten waren, die von Monterey nach Santa Fé reisten und als Geleite zweiundzwanzig Apachen nebst zwölf oder fünfzehn Cibolerosfamilien mitgenommen hatten. Ich kannte die Beamten und freute mich sehr, Nachrichten von Californien zu erhalten. Isabella war noch so schön als je, aber nicht mehr so leichtherzig. Padre Marini, der Missionär, hatte sich nach Peru eingeschifft, und die ganze Stadt Monterey lachte, tanzte, sang und liebte noch immer, wie zu der Zeit, da ich sie verlassen hatte.
Die Beamten gestatteten bereitwillig, dass ich sie nach Santa Fé begleitete, von wo aus ich mit der nächsten Caravane leicht nach Monterey zurückkehren konnte.
Ein Wort über die Ciboleros dürfte nicht uninteressant seyn. Jedes Jahr begeben sich grosse Abtheilungen von Mexikanern, einige mit Maulthieren, andere mit Ochsenkarren, in die Prairieen, um ihre Familien mit Büffelfleisch zu versorgen. Sie betreiben ihre Jagd meistens zu Pferd; ihre Waffe besteht in dem Pfeil, in der Lanze oder bisweilen auch in einem Gewehre, während sie ihre Beute auf die Karren oder Maulesel laden. Sie finden es nicht schwer, ihr Fleisch auch mitten im Sommer zu erhalten, indem sie es in dünne Schnitten zerlegen, in der Sonne ausbreiten, oder in der Eile wohl auch das ganze Thier braten.
Während des Einpöckelns befolgen sie oft die indianische Gewohnheit, das Fleisch mit den Füssen zu treten; sie sagen, dies trage zur Erhaltung bei.
Hieraus gewinnen wir einen merkwürdigen Beleg für die ausserordentliche Reinheit der Atmosphäre in jenen Gegenden. Neben dem Wagen ist von einer Ecke bis zur andern eine Leine gezogen, an der die Fleischstücke hängen bleiben, bis sie eingepackt werden können. Dies geschieht ohne Salz, und doch geht das Fleisch nur selten in Fäulniss über.
Sehr interessant ist die optische Täuschung, welche die feine und durchscheinende Atmosphäre dieser Hochebene bietet. Man könnte fast glauben, man blicke durch ein Fernglas, denn die Gegenstände erscheinen oft kaum in dem vierten Theile ihrer wahren Entfernung — häufig aber auch viel grösser und namentlich weit höher. Ich habe oft Antilopenhaufen für Triebe von Elennthieren oder wilden Pferden gehalten, in grösserer Entfernung sogar für Reiter, was nicht selten zu einem blinden Lärm Anlass gab. Eine Büffelheerde auf einer fernen Ebene zeigt sich oft so, dass ein ungewohntes Auge sie für einen grossen Wald halten könnte.
Eine höchst wunderbare, mitunter aber auch sehr quälende Erscheinung ist die Mirage, oder, wie sie gewöhnlich von den mexikanischen Reisenden genannt wird, „das lügende Wasser.“ In den dürren Ebenen, wo ein Teich so gelegen käme, werden oft sogar die erfahrenen Prairiejäger durch derartige Phänome getäuscht. Der durstige Wanderer erblickt nach stundenlangem Placken unter einem sengenden Himmel endlich einen Weiher — ja, es muss Wasser seyn — es sieht zu natürlich aus, als dass hier eine Täuschung obwalten könnte. Er beschleunigt seine Schritte in der süssen Vorahnung eines erfrischenden Trunkes, aber wie er näher kömmt, weicht das Truggebilde zurück, oder verschwindet ganz; steht er dann endlich auf der muthmasslichen Stelle desselben, so möchte er seinen eigenen Augen misstrauen, wenn er nichts als trockenen Sand unter seinen Füssen findet. Erst nach vielen Täuschungen verzichtet er auf solche Wasserspuren und lässt vielleicht auch einen wirklichen Teich unbeachtet, weil er abermals genarrt zu werden fürchtet.
Die Theorie derartiger trügerischer Wassergebilde, so weit ich davon Kunde erhielt (!), hat mich nie befriedigt. Gewöhnlich schreibt man sie einer Refraktion zu, durch welche ein Abschnit des Himmelsgewölbes unter den Horizont geworfen wird; ich bin übrigens überzeugt, dass sie eine Wirkung der Reflektion sind. Ein Gas, das wahrscheinlich der erhitzten Erde und ihren vegetabilischen Stoffen entströmt, schwimmt über den Hochebenen und besitzt hinreichende Dichtigkeit, um, wenn es in schiefer Richtung betrachtet wird, die jenseitigen Gegenstände zu reflektiren; in dieser Weise gibt der gegenüberliegende Theil des Himmels der Gasmasse, in welcher er sich wiederspiegelt, das Aussehen des Wassers.
Einen Beweis für meine Behauptung gibt der Umstand, dass ich oft bemerkt habe, wie die fernen Erdhügel und Bäume, welche jenseits der Mirage, in der Nähe des Horizonts, lagen, in dem „Teiche“ deutlich umgekehrt erschienen. Wäre nun das Phänomen ein Resultat der Refraktion, so müssten sich diese Gegenstände auch unter der scheinbaren Oberfläche aufrecht zeigen.
Ueberhaupt bemerkt man auf diesen Ebenen viele sonderbare athmosphärische Naturspiele, die dem Forscher ein reiches Feld für interessante Untersuchungen geben würden.
Wir hatten eine sehr angenehme Reise, obgleich wir mitunter schwer vom Hunger heimgesucht wurden. Gabriel, Roche und ich waren jedoch zu glücklich, um darüber Klage zu führen.
Wir machten eben erst eine bittere und lange Sklaverei abgeschüttelt und waren ausserdem der magern, zähen Hunde herzlich satt, welche den Winter über die einzige Nahrung der Arrapahoes sind. Die Apachen, welche von unsern Thaten gehört hatten, zeigten uns grosse Achtung; indess verdankten wir doch ihre Geneigtheit vornemlich der Geschicklichkeit unsers Irländers auf der Violine. Ein mexikanischer Beamter, der im letzten Herbst von Monterey nach Santa Fé abberufen worden war, hatte nämlich ein derartiges Instrument am ersteren Orte zurückgelassen. Da es eine schöne, alt-italienische Geige war, die ohne Zweifel einen bedeutenden Werth besass, so hatte der Eigenthümer einen der Beamten gebeten, sie mitzubringen, und so befand sie sich nun bei dem übrigen Gepäcke auf einem Cibolero-Wagen. Wir bemerkten dies bald und trösteten uns, wenn wir nichts zu essen kriegen konnten, mit Musik. So müde wir auch waren, konnten wir doch in unsern Standquartieren noch stundenlang tanzen — „wenigstens die Blassgesichter“ — bis der arme Roche vor Erschöpfung kaum mehr seine Finger zu rühren vermochte.
Endlich wurden wir unseres erzwungenen Fastens enthoben und konnten nun mit Verachtung auf die bescheidenen Stachelbirnen niederblicken, die so manchen langen Tag unsere einzige Nahrung gewesen waren. Täglich kamen uns jetzt Heerden von fetten Büffeln in den Wurf, und wir verfolgten rüstig die stämmigen Prairieenherren. Einer davon stiess jedoch mein Pferd zu todt und würde ohne Gabriels sicher gezielte Kugel wahrscheinlich auch meinen Abenteuern ein Ende gemacht haben, denn thörichterweise hatte ich meine Büchse gegen Bogen und Pfeile vertauscht, um meine Geschicklichkeit zu zeigen. Diese Eitelkeit kam mich theuer zu stehen, denn obgleich der Bulle ein schönes Thier war, und sieben Pfeile in seinem Halse stecken hatte, verlor ich doch eines der besten Pferde des Westens, und auch mein rechtes Bein wurde bedeutend verletzt.
Da ich in Erfahrung brachte, wir träfen unmittelbar auf unserem Wege eine grosse Republik von Prairiehunden,14) so ging ich mit meinen beiden Begleitern voraus, um ihre Niederlassung zu besuchen. Wir hatten dabei einen doppelten Zweck im Auge, denn erstlich gedachten wir, einen dieser Freistaaten, von denen die Prairiereisenden so viel erzählt haben, in Augenschein zu nehmen, und zweitens wollten wir uns einen hübschen Braten holen, da das Fleisch dieser Thiere vortrefflich schmeckt.
Sechs oder sieben Meilen weit führte uns unser Weg an den Seiten eines sanftansteigenden Gebirges hin. Auf der Höhe angelangt, fanden wir ein schönes Tafelland ausgebreitet, das nach allen Richtungen hin meilenweit reichte. Der Boden schien ungemein reich zu seyn und war üppig mit Musquit-Bäumen bewachsen. Das krause Musquito-Gras gehörte zu der süssesten und nährendsten Art, und die Hunde, die einzig hievon leben, schlagen ihre Stätte nur an solchen Orten auf, wo es in Hülle vorhanden ist.
Nachdem wir diese schöne Prairie erreicht hatten, gelangten wir bald zu den Aussenposten des Hundestaates. Ein paar einzelne Thiere