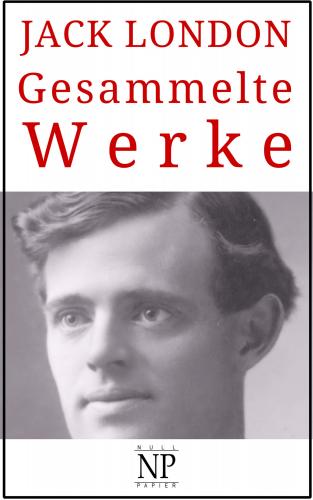Dann begann der Kampf im Halbdunkel. Der Indianer stieß mit seinem Messer auf den schnarchenden Borg ein. Aber das Licht war zu schwach, er hatte nicht den Mut gehabt, ihm die Decken wegzureißen. Borg fuhr auf, er war gleich bei voller Besinnung und fuhr dem Indianer an die Gurgel. Er schnellte sich aus dem Bett und fiel mit seinem ganzen Gewicht auf den Mann. Sie rangen um das Messer, Borg hatte es schon fast an sich gerissen, da biss der Mörder ihm in die Faust. Er bekam die bewaffnete Hand frei und stieß immer wieder zu. Sie wälzten sich gegen Tische und Stühle, dass das Holz zusammenkrachte, und dann fiel der erste Schuss.«
»Und du?«
»Ich wollte mich aufraffen, wollte um Hilfe brüllen oder mit einem Stuhlbein den Mörder erschlagen, aber ich konnte nicht. Wie an Händen und Füßen gefesselt lag ich da, Gott helfe mir. Bella hatte den ersten Schuss abgefeuert, auf Borg, aber er lebte immer noch. Er lebte noch und kämpfte noch, als wenn er drei Leben hätte. Er schrie sogar nach mir ›Hilfe! Helft mir doch, St. Vincent!‹ Aber dann war plötzlich keine Hilfe mehr nötig. Er hatte mit seiner eisernen Faust den Indianer knockout geschlagen, und dann lag Bella plötzlich wieder vor ihm, wie ich es oft gesehen hatte, wie ein Hund, der die Peitsche erwartet. Borg riss ihr den Revolver aus der Hand und schoss zweimal auf den Indianer. Seine Augen waren von strömendem Blut geblendet, er traf ihn nicht. Die Kugeln pfiffen scharf an meinem Kopf vorbei in die Wand. Ihr könnt sie dort noch finden. Ich glaube, er wollte den Indianer und mich zugleich erschießen, aber er fehlte uns beide. Den dritten Schuss gab er auf Bella ab, und der traf.
Alles andere war so, wie ihr es von den Zeugen gehört habt.«
Es entstand eine lange Pause. Kein Mensch wagte zu sprechen, aber wie zum Hohn dieses Lynchgerichtes, wie zum Triumph des Lebens, das nach jedem Grauen und zu jedem Entsetzen dennoch das letzte Wort spricht, schmetterte ein Rotkehlchen aus der Krone des Baumes herab, der eben noch als Galgen dienen sollte.
»Hängt ihn auf! Hängt ihn, dass Schluss wird! So eine feige Bestie hat kein Recht mehr zu leben!« riefen aus der Masse ein paar grimmige Stimmen. Aber die meisten der Männer waren jetzt ganz stumm und beklommen. Gestern noch hätte es ihnen nichts ausgemacht, St. Vincent am Galgen zu sehen. Aber in diese Morgenpracht hinein schien das Bild grässlich, und zudem war ihnen klar, dass auf ein Versagen der Nerven, selbst auf die erbärmlichste Feigheit, nach keinem menschlichen Gesetz der Tod steht.
In diesem Augenblick lenkte ein großes Floß, das an jedem Ende von einem Steuerriemen geführt wurde, in geräuschloser Fahrt in den Kanal ein. Als es der Richtstätte gerade gegenüberlag, wandte das vordere Ende sich dem Ufer zu, eine Leine wurde ans Land geworfen, dann kam mit gewaltigem Satz ein weißer Mann an den Strand, der die Leine ein paarmal um den Galgenbaum schlang.
»Lasst euch nicht stören, Jungens!« sagte der Mann, der mit einem Blick die ganze Situation erfasst hatte. »Wird schon richtig sein, was ihr da macht! Nur haben wir da einen Burschen an Bord, der auch nicht mehr lang’ zu leben hat. Vielleicht haben ein paar von euch Zeit, sich auch um den zu kümmern?«
Als ob die Goldgräber glücklich wären, einen anderen Gegenstand für ihre Aufmerksamkeit zu finden, wandten aller Augen sich jetzt dem Floß zu. Auch Jacob Welse, dessen Kopf verbunden war, der aber jetzt frischer und tatkräftiger aussah als am Tage zuvor, folgte den unerwarteten Vorgängen.
»Was habt ihr da für eine Ladung?« fragte er und wies auf einen Haufen Tannenzweige, mit denen das Floß gefrachtet war. Der andere Floßschiffer trat an die Fracht heran und warf ein paar von den Zweigen beiseite.
»Frisches Elchfleisch, Jungens!« rief er mit der Stimme eines Verkäufers auf dem Jahrmarkt. »Ausgezeichnete Ware! Frisches Fleisch, ihr Männer! Wenn wir bis Dawson fahren, reißen sie es uns aus den Händen, für 10 Unzen Goldstaub das Kilo! Aber weil ihr’s seid, und weil man sich den Weg nach Dawson auch sparen möchte, sollt ihr es billiger haben!«
»Und das ist, wie gesagt, die Fracht Nummer zwei«, sprach der erste Mann und wies auf die Umrisse einer Männergestalt, die mit vielen Decken verhüllt war.
»Den haben wir erst heute Morgen aufgelesen, so ungefähr 30 Meilen flussaufwärts.«
»Der braucht einen Doktor«, erzählte der Zweite. »Muss eine Meinungsverschiedenheit mit einem Grizzlybären gehabt haben, und der Bär hat das letzte Wort behalten. Aber wir haben keine Zeit. Entweder kauft ihr gleich oder gar nicht! Bei der Sonne hält sich das Fleisch nicht!«
Frona und St. Vincent sahen zugleich, wie der Verwundete die Böschung hinauf und durch die Menge getragen wurde. Eine bronzefarbene Hand hing schlaff von der rohgezimmerten Bahre herab, ein bronzefarbenes Gesicht kam zwischen den Decken zum Vorschein. Die Männer, die ihn trugen, machten in der Nähe des improvisierten Galgens halt, um zu beschließen, wohin sie ihn tragen wollten. Plötzlich fühlte Frona einen rasenden Griff an ihrem Arm. St. Vincent bohrte seine Nägel in ihr Fleisch.
»Sieh doch!« St. Vincent bebte an allen Gliedern, sein Gesicht mit den lodernden Angst-Augen war in diesem Augenblick noch weißer als zuvor.
»Schau hin! Die Narbe!«
Der Indianer schlug die Augen auf, sein leergeblutetes Gesicht verzerrte sich zu einer Grimasse des Erkennens.
»Das ist der Mann! Das ist der Mörder!« brüllte St. Vincent der Menge zu, mit einem ganz zerborstenen Organ. »Schaut ihn euch an, schaut die Narbe an! Das ist der Mann, der John Borg überfallen hat!«
Gleich darauf hätte man nicht mehr glauben können, dass soviel Menschen zusammengekommen waren, um über einen der Ihren hochnotpeinliches Gericht zu halten. Nur die Schlinge, die aus der Krone des Baumes herniederbaumelte, erinnerte noch an den Anlass zu dieser Versammlung. Aber St. Vincent selbst lag jetzt am Fuß des Baumes. Er streckte sich in der Sonne, und wahrscheinlich schlief er. Die Angst war von ihm genommen, nach vierundzwanzig Stunden des Zitterns und Zagens, nach einer Kette übermenschlicher Anstrengungen schlief er, wie jedes Wesen sich in den Schlaf flüchtet, um neue Kräfte zum Leben zu sammeln, auch unter dem Galgen.
Der verwundete Indianer war in eine Hütte getragen worden. Bei ihm saßen Jacob Welse, der Vorsitzende des Gerichtes und La Flitche. Sie versuchten in vielen Indianersprachen, ihn zum Sprechen zu bringen. Mit seinem letzten Atem sollte er die Wahrheit bekennen. Nach langem Suchen probierte La Flitche es mit einem Dialekt, den er in Kindertagen einmal gelernt und beinahe wieder vergessen hatte. Bei den ersten Lauten fuhr über das Gesicht des Sterbenden ein frohes Aufleuchten …
1 Prahlhans, Aufschneider <<<