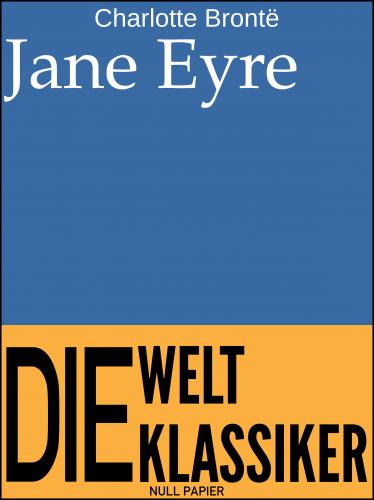Mein Lieblingssitz war ein breiter, glatter Stein, welcher weiß und trocken mitten aus dem Waldbache herausragte; er war nur zu erreichen, indem ich durch das Wasser watete, und diese Tat vollbrachte ich denn ziemlich oft und zwar barfuß. Der Stein war gerade breit genug, um außer mir noch einem anderen Mädchen bequemen Platz zu gewähren; dies war Mary Ann Wilson, damals meine auserwählte Gefährtin; sie war ein kluges, beobachtendes Geschöpf, deren Gesellschaft mir Freude machte, teilweise weil sie witzig und originell war, und teilweise, weil sie Manieren und Sitten hatte, welche mir besonders zusagten. Um einige Jahre älter als ich, kannte sie mehr von der Welt und konnte mir von vielen Dingen erzählen, die ich gern hörte; in ihrer Gesellschaft wurde meine Neugierde befriedigt; mit meinen Fehlern hatte sie die größte Nachsicht und niemals versuchte sie meinen Worten Zwang oder Zügel anzulegen. Sie hatte ein großes Erzählertalent, – ich besaß Talent für die Analyse; sie liebte es zu belehren – ich zu fragen; so wurden wir prächtig miteinander fertig und zogen wenn auch nicht viel Belehrung, so doch viel Vergnügen aus unseren gegenseitigen Verkehr.
Und wo war inzwischen Helen Burns? Weshalb brachte ich diese süßen Tage der Freiheit nicht in ihrer Gesellschaft zu? Hatte ich sie vergessen? Oder war ich so leichtsinnig, so unwürdig, dass ich ihrer veredelnden Gesellschaft müde geworden? Gewiss war die obenerwähnte Mary Ann Wilson jener meiner ersten Freundin nicht ebenbürtig; sie konnte mir nur lustige Geschichten erzählen oder irgend einen witzigen Klatsch wiederholen, der mir gerade Vergnügen machte, während Helen, wenn ich die Wahrheit über sie gesprochen habe, geeignet war, denen, welche das Vorrecht, die Begünstigung ihrer Unterhaltung genossen, Sinn und Geschmack für höhere, reinere Dinge einzuflößen.
Das ist wahr, mein teurer Leser, und ich wusste und fühlte das; – und obgleich ich ein unvollkommenes Geschöpf bin mit vielen Fehlern und wenigen guten Eigenschaften, so war ich Helen Burns’ doch noch niemals überdrüssig geworden; niemals hatte ich aufgehört, für sie eine Liebe zu hegen, die so stark, so zärtlich und so achtungsvoll war, wie nur je ein Gefühl mein Herz bewegt hat. Wie hätte es denn auch anders sein können, wenn Helen zu allen Zeiten und unter allen Umständen mir eine ruhige und treue Freundschaft bewiesen hatte, welche keine böse Laune je verbitterte, kein Streit jemals störte? – Aber Helen war augenblicklich krank; seit mehreren Wochen war sie meinen Augen bereits entrückt; ich wusste nicht, in welchem Zimmer sie sich jetzt befand. Man hatte mir gesagt, dass sie sich nicht in der Hospitalabteilung unter den Fieberkranken befände; denn ihre Krankheit war die Schwindsucht, nicht der Typhus, und ich in meiner Unwissenheit stellte mir unter Schwindsucht etwas mildes vor, das durch Pflege und Fürsorge mit der Zeit geheilt werden müsse.
In dieser Idee wurde ich noch dadurch bestärkt, dass sie einigemal an sonnigen, warmen Nachmittagen herunter kam und von Miss Temple in den Garten geführt wurde; bei diesen Gelegenheiten gestattete man mir aber nicht, mit ihr zu sprechen oder mich ihr auch nur zu nähern; ich sah sie nur aus dem Fenster des Schulzimmers und dann nicht einmal deutlich; denn sie war in viele Tücher gehüllt und saß in einiger Entfernung auf der Veranda.
Eines Abends im Anfang des Monats Juni war ich sehr spät mit Mary Ann im Walde geblieben; wie gewöhnlich hatten wir uns von den anderen getrennt und waren weit gewandert, so weit, dass wir den Weg verloren und denselben in einer einsamen Hütte erfragen mussten, wo ein Mann und eine Frau wohnten, die eine Herde voll halbwilder Schweine zu hüten hatten, welche von der Eichelmast im Walde gemästet wurden. Als wir endlich zurückkamen, war der Mond schon aufgegangen; ein Pony, welches wir als dasjenige des Arztes erkannten, stand an der Gartenpforte. Mary Ann bemerkte, dass wahrscheinlich irgendjemand schwer erkrankt sein müsse, wenn Mr. Bates noch so spät am Abend geholt worden sei. Sie ging in das Haus; ich blieb zurück, um noch eine Handvoll Wurzeln, die ich im Walde ausgegraben, in meinem Garten einzupflanzen; ich fürchtete, dass sie bis zum nächsten Morgen verwelken würden. Nachdem dies geschehen, verweilte ich noch einige Minuten; die Blumen dufteten so süß, als der Tau fiel; es war ein so wunderschöner Abend, so rein, so ruhig, so warm; und der noch gerötete Westen versprach wiederum einen schönen Tag. Im dunklen Osten stieg majestätisch der Mond empor. Ich beobachtete dies alles und freute mich daran, wie ein Kind sich zu freuen vermag, – da plötzlich kam mir der Gedanke, wie niemals zuvor:
»Wie traurig ist es doch, jetzt auf dem Krankenbett liegen zu müssen und in Todesgefahr zu schweben! Diese Welt ist so schön – wie entsetzlich wäre es, abberufen zu werden und wer weiß wohin gehen zu müssen!«
Und dann machte meine Seele die erste ernste Anstrengung, das zu begreifen, was man in Bezug auf Himmel und Hölle in sie gelegt hatte; zum ersten Mal blickte ich um mich und sah vor mir, neben mir, hinter mir nichts als einen unermesslichen Abgrund; zum ersten Mal bebte meine Seele entsetzt zurück, sie empfand und fühlte nichts sicheres mehr als den einen Punkt, auf welchem sie stand – die Gegenwart, alles andere war eine formlose Wolke, eine unergründliche Tiefe – es schauderte mich bei dem Gedanken zu straucheln, zu wanken – und in das Chaos hinabzutauchen. Als ich noch diesen neuen Gedanken nachhing, hörte ich, wie die große Haustür geöffnet wurde; Mr. Bates trat heraus, mit ihm eine Krankenwärterin. Nachdem sie gewartet bis er aufs Pferd gestiegen und fortgeritten war, wollte sie die Tür wiederum schließen. Ich lief zu ihr.
»Wie geht es Helen Burns?«
»Sehr schlecht«, lautete die Antwort.
»War Mr. Bates ihretwegen gekommen?«
»Ja.«
»Und was sagt er?«
»Er sagt, dass sie nicht mehr lange bei uns verweilen wird.«
Hätte ich diese Phrase gestern gehört, so würde sie nur den Glauben in mir wachgerufen haben, dass man sie nach Northumberland