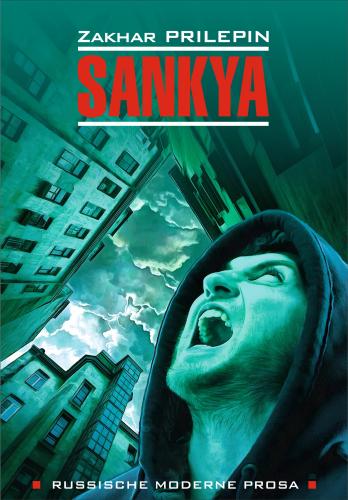Die Großmutter kochte gleichzeitig mit zwei Pfannen – in einer wärmte sie Kartoffeln und Fleisch auf, in der zweiten zischten und zerbarsten Saschas geliebte Karawajtschiki*, dünne, fast durchsichtige Pfannkuchen mit einem süßen, knusprigen, dunklen Muster am Rand. Die Großmutter kochte ohne Hast, geschickt und behände, dachte nicht daran, dass sie kochte, und hätte wahrscheinlich die Augen dabei schließen können, sich im Geiste von dem, was sie tat, ganz und gar entfernen: »Heuer im Winter haben wir die letzten Enten geschlachtet«, erzählte die Großmutter, während sie Kartoffeln und Fleisch in der Pfanne umdrehte, »ich hab keine Kraft mehr, zum Bach zu gehen. Runter geht’s, aber zurück nur mühsam, die Enten warten auf michund rufen mich.«
Die Großmutter wechselte übergangslos von einem zum anderen, es ging aber immer um eines: Alle sind gestorben und es gibt nichts mehr.
»Opa ist völlig taub, er hört nichts mehr … Das letzte Mal ist er im Juni aufgestanden. Er ging aufs Klo und fiel im Hof nieder. ›Warum bist du aufgestanden?‹ fragte ich ihn. ›Ich hab dir doch einen Kübel hingestellt!‹« Er war mit letzter Kraft aufgestanden.
Die Großmutter drehte das Feuer unter der Pfanne mit den Kartoffeln und dem Fleisch zurück, nahm den letzten Karawajtschik aus der anderen Pfanne und ging in die Hütte.
Sascha stand auf, torkelte durch die Küche und ging auf die Straße, um zu rauchen. Beim Hinausgehen hörte er, wie die Großmutter laut zu Opa sagte: »Sankya ist gekommen! Sankya!«
»Sankya? Was kommt er denn nicht herein? Ich höre, dass du dort mit jemandem schwätzt.«
Es war völlig dunkel. Das Dorf war lautlos.
Das Kind war weggegangen. Neben der Pfütze lag seine Gerte.
Die Zigarette brannte. Die Asche fiel nicht hinunter.
Ein Betrunkener stapfte vorbei, ein verkümmertes Männlein, das Sascha nicht beachtete.
»Was kommst du denn nicht zu mir, Sankya?«, fragte der Opa, als Sascha die Hütte betrat und sich an Opas Bett setzte.
In seiner Stimme schwang kaum hörbar die Ironie des Alten mit – fürchtest dich wohl vor mir, deinem sterbenden Opa. Und in der Ironie war zugleich Mitleid zu hören – na ja macht nichts, Jungchen, ich halte dich nicht lange auf.
Opa war dünn geworden, die spitzen Schultern, die schwachen Augen klebten zusammen. Der Großvater bereitete sich aufs Sterben vor. Wenn er sprach, knackste es kaum hörbar im Hals und die Wörter kamen praktisch unverständlich heraus.
»Sterben ist nicht schrecklich, Sankya … Das Leben ist sehr lang. Es reicht schon. Da liege ich jetzt und kann nicht sterben. Ach Sankya, Sankya …«
Sascha blickte den Opa schweigend an.
»Lass ihn doch erst mal essen nach der Reise!«, sagte die Großmutter, die hereingekommen war. »Du wirst noch genug reden können! Du stirbst schon nicht, während er isst!«
»Lass ich ihn etwa nicht essen?«, antwortete der Opa. »Geh essen, Sankya …«
Sascha ging folgsam in die Küche. Der Opa murmelte etwas, sprach mit geschlossenen Augen mit jemandem.
Die Großmutter fragte Sascha nach der Mutter, ob die Mutter nicht wieder heiraten werde, ob er selbst nicht trinke und wo er jetzt arbeite. Die Mutter wird nicht heiraten, Sascha trinkt nicht, zumindest nicht so, wie die Großmutter meinte, über die Arbeit erzählte er Lügen. Er arbeitete, war aber zu faul zu erklären, was er tat. Für die Alten ist Arbeit die Erde pflügen oder Fabrik, oder das Krankenhaus, oder die Schule … Sie haben recht. Aber heute ist diese Arbeit in den meisten Fällen zum Schicksal von nicht sehr erfolgreichen, vom Leben benachteiligten Menschen geworden.
Die Großmutter trug auf – wie man das im Dorf so nannte – und Sanja trank den Selbstgebrannten gerne zu Fleisch und Kartoffeln, um sich ein bisschen zu erleichtern.
Er trank einmal, zweimal, dreimal.
Im Nebenzimmer lag der Großvater im Sterben. Sascha aß mit großem Appetit. Er war hungrig. Die Karawajtschiki schmeckten so gut wie in der Kindheit. Die Großmutter erzählte davon, was im Dorf passierte.
Im letzten Haus in der Straße lebte ein Mann mit Spitznamen Chomut. Sascha kannte ihn gut. Chomut hatte ihn, Sascha, gerettet. Und der Vater hatte Chomut auch gekannt, sie waren befreundet; ihre Freundschaft war unspektakulär und still gewesen.
Chomut war gesund, helläugig, stark wie ein Pferd. Letzten Sommer hatte er sich erhängt. Die Söhne waren aus der Stadt zu ihm gekommen, um im Gemüsegarten zu helfen. Bei der Arbeit im Gemüsegarten zerstritt sich Chomut mit den Söhnen. Er hatte sich mit ihnen noch nie gut verstanden.
Er schimpfte und sagte: »Ich werde es euch jetzt mal zeigen!« Er ging ins Haus. Die Söhne zuckten nur mit den Schultern und arbeiteten weiter. Als sie dann heimkamen, fanden sie den Vater im Schuppen, er hatte sich an einer Querstange erhängt, die Beine angezogen.
Chomut gab’s jetzt also nicht mehr.
Zwei Häuser neben Saschas Geburtshaus lebte ein Mann mit Spitznamen Kommissar gemeinsam mit seiner Mutter. Kommissar wurde er deshalb genannt, weil er in den letzten fünf Jahren nichts getan hatte, als die Dorf bewohner zu beobachten, vom frühen Morgen an stand er an den Zaun gelehnt da. Er ließ sich scheiden, lebte von der Pension seiner Mutter. Sascha spürte in ihm immer etwas Ungesundes. Womit beschäftigt sich so ein vierzigjähriger Bock ohne Frau den ganzen Tag? Die Tochter wächst allein in der Stadt auf, ist noch ganz klein … Bei einem derartigen Leben kann man sich ja nur auf hängen. Aber er hängte sich nicht auf. Zuerst war sein stilles Mütterchen gestorben, und bald starb auch er selbst, irgendwas mit dem Herzen.
Zwei Söhne einer unmittelbaren Nachbarin starben schon damals, als Saschas jüngster Onkel verunglückte[60]. Auch die Nachbarsjungen verunglückten, auch mit den Motorrädern. Das kam so: In den letzten Jahren der ehemaligen Regierung hatte die Bauernschaft – endlich – Fleisch angesetzt und ein wenig Geld angesammelt. Das Erste, was einer aus dem Dorf macht, der sein ganzen Leben im Schweiße seines Angesichts geschuftet hatte: Er verhätschelt sein Kind, wie alt es auch sein mag. In jenen Jahren wollten die Jungs aus dem Dorf vom Fahrrad aufs Motorrad umsteigen. Im Dorf gab es keine Verkehrspolizisten, ja, auch den Revierinspektor sah man monatelang nicht, also fuhren alle betrunken. Und sofort fingen die Unfälle an: Sie verunglückten schrecklich, wurden in Stücke zerfetzt, vor dem Tod segelten sie – schlagartig aus dem Sattel gehoben, fünfzig, ja oft siebzig Meter weit, zertrümmerten ihre blöden Köpfe an Bäumen und Zäunen, brachen sich alle Knochen, ihre Körper verwandelte sich in weichen rosafarbenen Matsch, und manchmal traf es auch junge Mädchen, die auf dem Rücksitz gesessen hatten. Und wenn die Mädels auch nicht starben, so brachen sie sich die Wirbelsäule und lagen dann bewegungsunfähig da, wiederholten in Gedanken jede Minute jenes unglücklichen Abends.
Sascha, der als Kind immer in den Dorfladen gelaufen war, um Brot zu holen, traf dort drei, manchmal fünf und mehr Frauen in schwarzen Kleidern; ihre Söhne waren alle verunglückt. Die Frauen standen da und sprachen leise davon, wie ihre Kinder gelebt hatten und wie sie gestorben waren. Und einige der Wörter, die er im Vorbeigehen aus den schwarzen Mündern der Frauen hörte, schwirrten noch lange in Saschas Kopf herum, ohne den richtigen Platz zu finden.
Manche verließen das Dorf in den letzten Jahren, erzählte die Großmutter; jemand war an einer frühen Krankheit still gestorben, und im Großen und Ganzen war ein einziger Mann übrig geblieben, der – niemand erinnerte sich daran, warum eigentlich – Solowej, die Nachtigall, genannt wurde. Er betrank sich jeden Abend – man wusste nicht wo —, kam nach Hause, schrie seine sprachlose Frau blöde an, die längst schon alles verdammt hatte und in ihrer Ausweglosigkeit verstummt war. Kinder hatten sie keine. Abends hörte man im fast leeren Dorf Solowejs Gebrüll.
War er betrunken, erkannte er kaum jemanden, ging durchs Dorf, ohne etwas zu bemerken, und nur der wehmütige