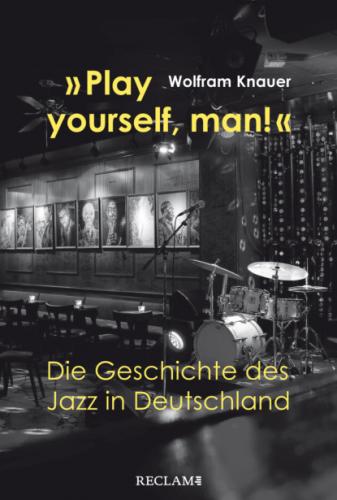Schon lange vor dem Jazz also waren in Deutschland schwarze Menschen im Frack auf der klassischen Bühne genauso zu erleben wie im Bastrock bei den Völkerschauen. Daneben aber hatten sie sich einen festen Platz im Varietétheater erobert. Allein 1896 gab es mehr als 100 schwarze Künstler, also Sänger, Musiker, Stepp- oder akrobatische Tänzer, die auf deutschen Varieté- und Konzertbühnen auftraten, wie Der Artist auflistet, das wichtigste Branchenblatt.10
Anfang des 20. Jahrhunderts kamen die ersten Ragtime-Kompositionen im Druck auch auf den europäischen Markt. Oft wurden die Klavierstücke mit Tänzen verbunden, und meist hatten diese mit den neuesten Moden des anbrechenden Jahrhunderts zu tun, mit dem Cakewalk, dem Tango, dem Foxtrott oder dem Shimmy.
Erste afro-amerikanische Aufnahmen in Europa
Die Historiker Jeffrey Green, Rainer E. Lotz und Howard Rye haben 2013 eine große Ausgabe aller Aufnahmen schwarzer Künstler in Europa vor 1927 vorgelegt, in der die Vielfalt des künstlerischen Ausdrucks auf dem alten Kontinent deutlich wird. Tänzer und Banjovirtuosen, klassisch geschulte Sopranistinnen, Komiker, Kontorsionisten und andere Artisten waren regelmäßige Gäste auf den Varietébühnen und prägten die Vorstellung von schwarzer Kunst als einer fremdartigen, aber mitreißenden Unterhaltung. Wo vielleicht anfangs »schwarz« noch mit Afrika gleichgesetzt wurde, da waren nach und nach vor allem die Afro-Amerikaner gefragt, deren Kunst bei aller Gewagtheit eben doch auch europäische Elemente enthielt und so das Erlebnis von Fremdheit innerhalb des Bekannten erlaubte.
Da gibt es etwa Seth Weeks’ virtuose Mandolinen-Interpretationen von Franz von Suppés Dichter und Bauer-Ouvertüre, Johannes Brahms’ »Ungarischen Tänzen« oder seine Version des Cakewalks »At a Georgia Camp Meeting«, aufgenommen mit Klavierbegleitung im Jahr 1901, die durchaus in der Tradition europäischer Salonmusik zu hören sind. Da gibt es Einspielungen der Coloured Meisters, eines Ablegers der Fisk Jubilee Singers, aus dem Jahr 1906, die deutlich machen, dass Spirituals neben humoristischen Liedern inzwischen nur noch einen Teil im Repertoire dieses Männergesangsquartetts ausmachten. Arabella Fields’ »Negerlieder«, 1907 in Berlin aufgenommen, sind populäre Kunstlieder, operettenhaft vorgetragen von der »schwarzen Nachtigall«, als welche die 1879 in Philadelphia geborene Sängerin überall in Europa angekündigt wurde. Oder es gibt die Aufnahmen von Musikern der Four Black Diamonds aus dem Jahr 1913, in denen deutlich der Einfluss sowohl von Music-Hall, Minstrel-Show und Ragtime durchscheint. Wir hören in all dem eine aufs europäische Publikum gerichtete Konzertmusik und können den Programmzetteln entnehmen, dass diese in abwechslungsreichen Programmen vorgetragen wurde, in denen die Exotik durch Tänze, Bühnenbild und die Hautfarbe der Künstler weit stärker zu erleben war als im reinen Höreindruck. Jazzelemente, wie wir sie heute kennen, also beispielsweise die jazztypischen Instrumente späterer Jahre, kollektive oder solistische Improvisationen über klaren Formgerüsten oder die Bluesintonation, die sich um 1920 in amerikanischen Aufnahmen findet, sind bei alledem allerdings herzlich wenig zu hören.
Der Siegeszug des Jazz beginnt
1915 änderte sich das langsam. Der Ragtime eroberte die Welt, auch ohne dass die Plattenindustrie, die ja noch in ihren Kinderschuhen steckte, dies dokumentierte. Irving Berlins »Alexander’s Ragtime Band« war 1911 zu einem internationalen Hit geworden, zu dem in London genauso getanzt wurde wie in Berlins Geburtsnation Russland. 1913 schrieb er »That International Rag«, wie sein erster Hit eine Komposition, die vor allem die Synkopen aus dem Ragtime nahm, ansonsten aber operettenhaft auf die populäre Broadway-Bühne schielte. Im Text immerhin heißt es, und dies ist ein direkter Hinweis darauf, dass sich alle bewusst waren, an der ersten globalen Vermarktung von Musik beteiligt zu sein: »London dropped its dignity / So has France and Germany / All hands are dancing to a raggedy melody / Full of originality«.
Am 26. Februar 1917 also ging die Original Dixieland Jazz Band ins Studio, und der Erfolg der Aufnahme veränderte zweierlei grundlegend: die Bedeutung der Schallplatte für die Musikindustrie und die Wahrnehmung des Jazz. Anders als die auf auskomponierten Formen basierende europäische Kunstmusik schließlich, zu der ich hier auch die populäre Musik der Zeit, die Operetten und Music-Hall-Schlager zählen möchte, war der Jazz im besten Sinne eine Momentkunst. Sein wesentliches Element, die Improvisation, ließ sich nicht notieren, die Instrumentenbehandlung hielt den hergebrachten Vorstellungen eines »schönen Klangs« nicht stand, wirkte mal archaisch, mal einfach nur amüsant. Mit dem öffentlichen Konzert James Reese Europes am 12. Februar 1918 in Nantes, bei dem das Publikum insbesondere die Kraft der Improvisation spürte, begann der Jazz sich seinen Platz in der europäischen Musikgeschichte zu erobern: Neben der durchgeplanten gab es hier offenbar eine natürliche Art der Dramaturgie, die »aus dem Bauch« heraus kam, die man irgendwie noch aus kultureller Erinnerung kannte, die aber spätestens im angehenden 19. Jahrhundert mehr und mehr der Präzision ausgetüftelter Komposition gewichen war. Die improvisatorische Kraft dieser Musik war so direkt, so emotional geladen, so mitreißend, dass das Publikum nicht anders konnte, als begeistert zu reagieren. Der Jazz – den man zu der Zeit ja noch gar nicht unbedingt mit diesem Namen belegte – hatte beste Aussichten, einen neuen Markt zu erobern. Dieser wurde allerdings anfangs nicht etwa von der doch noch recht neuen Schallplatte bedient, sondern von möglichst vielen Bands, die versuchten, dem Geheimnis der neuen Musik auf die Spur zu kommen.
Von Anfang an hatten amerikanische Musiker einen klaren Vorsprung auf diesem Markt. Wie eine Jazzband idealerweise besetzt sein sollte, wusste man allerdings gar nicht so genau. Die Original Dixieland Jazz Band hatte immerhin ein Beispiel gegeben, ihre Bilder wurden schnell ikonisch: Schlagzeug mit riesiger Basstrommel, Posaune, Kornett, Klarinette und Klavier. Dan & Harvey’s Jazz Band dagegen, die 1918 und 1919 in London Aufnahmen machte, spielte in der Besetzung Geige, Cello, Klavier, Banjo und Schlagzeug. Das populäre Savoy Quartet, dessen Titel »The Jazz Band« von Januar 1919 den Sieg über Deutschland genauso besingt (»I’m the leader of a big jazz band, and we’re all Berlin bound«) wie den amerikanischen Süden (»Way down South in the land of cotton«), bestand aus zwei Banjos, Klavier und einem einfachen Schlagzeug plus Sänger. Die Versatile Four war ebenfalls eine String Band mit zwei Banjolinen (Mandolinenbanjos), Klavier und effektvoll eingesetztem Schlagzeug, deren Musik (etwa im »Down Home Rag« vom Februar 1916) für moderne Ohren wie eine Mischung aus Country- und Zirkusmusik klingt, einschließlich antreibender Zwischenrufe und Trillerpfeife. Dreieinhalb Jahre später hört sich die Besetzung schon erheblich jazziger an, etwa in »After You’ve Gone« vom September 1919 mit einem relaxed wirkenden Banjosolo und einem Saxophon als zweite Stimme. Beide, das Savoy Quartet und die Versatile Four, waren vor allem in England aktiv, und doch muss man sich Aufnahmen wie diese vor Ohren halten, um zumindest einen Klangeindruck dessen zu erhalten, was man schon vor 1920 in Europa hören konnte.
Im Vergleich zu den Einspielungen der Original Dixieland Jazz Band ist all diese brave, an Ragtime-Songs der Zeit orientierte Musik weit entfernt von der Wildheit, die man auch aus den Aufnahmen James Reese Europes aus denselben Jahren erahnen kann. Man erhält vor allem einen Eindruck von der Bandbreite dessen, was an klanglicher Erfahrung vom Publikum damals als Jazz wahrgenommen wurde. Doch leider sind in diesen Kindertagen der Schallplatte vergleichsweise wenige Aufnahmen entstanden, und wir sind vor allem auf Zeitzeugenberichte angewiesen. Die beweisen, dass das Phänomen »Jazz« faszinierte, ohne dass man genau wusste oder gar definieren konnte, was das eigentlich war.
So war bis in die frühen 1920er Jahre hinein eines der größten Missverständnisse des europäischen Publikums über Jazz jenes, dass die Menschen »Jazz« vor allem als einen Tanz ansahen, nicht als Musik. In einem der ersten deutschsprachigen Bücher, welches das Wort »Jazz« im Titel führt, in F. W. Koebners Brevier der neuesten Tänze von 1921, ging es beispielsweise um Jazz und Shimmy. Die Europäer hatten anfangs also eine uneinheitliche und von Klischees geprägte Vorstellung von Jazz: Den einen stand er für mehr oder weniger wilde, auf jeden Fall ungewöhnliche Tänze. Den anderen waren vor allem die seltsamen Klänge wichtig, die von ungewöhnlichen Instrumenten kamen, Saxophonen, Banjos, Schlagzeug. Die dritten hoben darauf ab, dass mindestens ein Musiker schwarzer