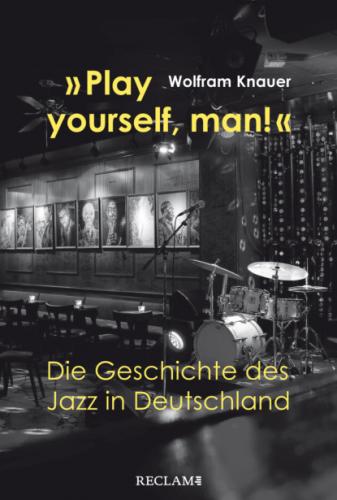— 1 —
Spirituals im Kaiserreich
Die Geschichtsbücher wissen ein Geburtsdatum des Jazz. Am 26. Februar 1917 nahm die Original Dixieland Jazz Band zwei Titel für die Victor Talking Machine Company auf, den »Livery Stable Blues« und den »Dixie Jazz Band One Step«. Die Titel wurden gepresst und kamen am 7. März 1917 auf den Markt: die erste Schallplatte des Jazz. Das Jahr 1917 also ging in die Annalen als das Geburtsjahr des Jazz ein. Doch so einfach ist es natürlich nicht. Ein Genre entsteht nicht einfach so, weil eine Kapelle ein Aufnahmestudio betritt und eine Platte einspielt. Musikalische Stilrichtungen entstehen über viele Jahrzehnte hinweg, sind das Ergebnis eines musikalischen Diskurses, der oft gar nicht im Öffentlichen verhandelt wird, sondern in einer weit weniger dokumentierten Öffentlichkeit.
Der Jazz hatte sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den amerikanischen Südstaaten herausgebildet als eine Musik für Ensembles, die die musikalischen Moden der Zeit aufnahm, die Bluesform, den Ragtime, die Hymnen der schwarzen Kirche, die Mazurka, schottische und irische Tanzstücke, leichte Salonpiècen, Marschmusik. Der Jazz war als eine Musik entstanden, die der Feier des Lebens genauso wie der Feier des Todes diente, die in der Community verankert war, die Menschen bei Freud und Leid begleitete. Die Menschen mochten die antreibende Kraft dieser Musik, die mehr Volksmusik war als Kunst; ihnen gefiel die Kraftmeierei der jungen Musiker, die zeigen wollten, wie schnell, wie laut, wie schräg sie klingen konnten. Sie waren von der gezügelten Wildheit dieser Musik begeistert, die auch die Zuhörer mitriss und so ganz anders war als die gemäßigte Tanzmusik, die man sonst so hörte, die langsamen Walzer und Quadrilles, die auf den Bällen des Südstaaten-Adels getanzt und die von anderen Gesellschaftsschichten weit kruder und archaischer nachgeahmt wurden.
Der Jazz war von Anfang an eine Musik der Unterschicht gewesen, eine Musik der Schwarzen im tiefsten, vom Rassismus und der Unterdrückung geprägten Süden der Vereinigten Staaten. Er hatte die Gesänge der Sklaven aus den Baumwollfeldern in sich aufgesogen und die klagend-hoffenden Spirituals der schwarzen Kirche, die Field Hollers und die Straßenhändlerlieder. Die Musiker bewiesen von den ersten Tagen des Jazz an große Ohren, lauschten den Überresten afrikanischer Rituale und den protestantischen Hymnen, den irischen Jigs und den schottischen Reels, dem Gesang der deutschen Männerchöre und den Proben der französischen Oper.
Gab es Jazz bereits vor 1917? Aber natürlich! In New Orleans oder in Charleston, South Carolina, in den großen Städten der Südstaaten, auf den Plantagen der Post-Sklaverei, überall entlang des Mississippi erklang Musik. Es gab Sänger, die in Balladen vom Leben und Sterben, von der Liebe und von abgrundtiefer Hoffnungslosigkeit sangen. Es gab Virtuosen auf den unterschiedlichsten Instrumenten, Gitarre, Banjo, Fidel, Perkussion, die mit den Märkten herumzogen und für die Unterhaltung bei Festen sorgten. Es gab Bluesbarden, die sich selbst auf der Gitarre begleiteten – Ruf, Ruf, Antwort – und deren Texte Kommentare zum eigenen Leben, zum Schicksal der Community oder zu gesellschaftlichen Entwicklungen im Land abgaben. Es gab Marschkapellen, die sich in Uniform und Aufstellung wie Militärbands gerierten, deren Märsche aber mangels Ausbildung und Notenfestigkeit der Musiker oft rauer und archaischer klangen. Es gab Ragtime-Pianisten, die meist auch ihre eigenen Stücke schrieben und so die ersten Komponisten eines mehr und mehr als afro-amerikanisch wahrgenommenen Genres waren.
Die Tatsache, dass vor der Original Dixieland Jazz Band wenig von der Musik, die da im Süden erklang, aufgezeichnet wurde, bedeutet nicht, dass da nichts gewesen sei. Es existieren Aufnahmen schwarzer Ensembles bereits von 1913 und 1914, die deutlich vermitteln, dass das Klangbild des späteren Jazz auch ganz anders sein konnte als jenes, das die Original Dixieland Jazz Band bot; durcharrangiert, mit antreibenden Zwischenrufen und offenbar bereits mit Freiraum für Gruppenimprovisationen, wenn diese auch auf den Aufnahmen selten zu hören sind.
Der Jazz also entstand nicht 1917, und er entstand auch nicht einzig in New Orleans. Aber etwa um 1917 wurde er in den USA und schnell weit darüber hinaus als eine Musik wahrgenommen, die eine enorme emotionale Wirkung hatte, die jung war, Kraft und Energie besaß, die die Wirren und Betriebsamkeit des neuen Jahrhunderts in den Griff zu bekommen schien, ohne sie aufzulösen.
Und damit sind wir schon bei einem Aspekt, der weit über den Jazz hinausgeht. In der afro-amerikanischen Kultur wurden die verschiedenen aus ihr generierten Musikstile als Ausdruck des täglichen Lebens wahrgenommen. Mit den Schallplatten der Original Dixieland Jazz Band entstand eine musikalische Mode, ein erstes Produkt der sich immer stärker herausschälenden Musikindustrie, das über die Gruppen hinaus wirkte, in denen es ursprünglich entstanden war, über die afro-amerikanische Gemeinschaft also, aber auch über die Menschen aus den Südstaaten, die sich mit diesen Klängen an ihre Heimat erinnert fühlten. Das große Missverständnis des Jazz, der als eine der kreativsten musikalischsten Kräfte des 20. Jahrhunderts wirken sollte, begann gleich bei der ersten offiziellen Aufnahme. Denn wo der Jazz in seiner heimischen Umgebung sehr klare Community-Funktionen innehatte, wurde er in New York, Chicago, Boston und den anderen Großstädten, in denen sich diese Platten schnell verbreiteten, vor allem als Mode wahrgenommen, als Trend bar jeder gesellschaftlichen Aufgabe, als ein Produkt der neuen Unterhaltungsindustrie, die für jedermann zugänglich war, schichten- und klassenübergreifend. Von Anfang an hörten die Tänzer, hörten die Käufer der Platten nicht nur die Musik, sondern ganz unterschiedliche Hoffnungen, die sie in diese Musik hineininterpretieren konnten.
Eine amerikanische Armeekapelle in Europa
Wir schreiben also das Jahr 1917. Am 7. März war die erste Jazzplatte erschienen, am 6. April traten die Vereinigten Staaten in den Ersten Weltkrieg ein. In Europa hatte dieser »Große Krieg« bereits Zehntausende an Todesopfern gefordert und ganze Länder in die Krise gezogen. Dieser Krieg hatte eine neue Dimension. Er wurde nicht am grünen Tisch und in begrenzten Schlachtgebieten ausgefochten. Er war so ausufernd und mit den neuen Kriegswaffen so vernichtend, dass jeder Mann und jede Frau betroffen war, dass sich ganze Länder die Frage nach ihrer Existenz stellen mussten. Wenn Staaten sich so vollends vernichten wollen und können, welchen Wert haben dann alle kulturellen Errungenschaften, die über Jahrhunderte entstanden sind und die ja neben der Entspannung immer auch einem gesellschaftlichen Gleichgewicht dienen?
Am 25. Dezember 1917 wurde das 15. Infanterie-Regiment der Vereinigten Staaten der 185. Brigade zugeordnet und auf den Weg nach Frankreich geschickt. Die Soldaten waren zur einfachen Arbeit abkommandiert, nicht zum Kampf. Am 1. März 1918 wurde das Regiment zum 369. Infanterie-Regiment umbenannt, am 8. April der französischen Armee zugeordnet. Die Arbeitssoldaten erhielten Waffen, trugen aber weiterhin ihre amerikanischen Uniformen. Im September waren sie zusammen mit französischen Truppen in Kämpfe verwickelt worden, kamen aber trotz schwerer Gegenwehr bis in die Vogesen durch. Dort waren sie am Tag des Waffenstillstands, am 11. November 1918, und sie erreichten als erste Soldaten der alliierten Streitkräfte sechs Tage später den Rhein. Das alles wäre nichts weiter als eine von vielen Kriegsgeschichten, hätte dieses Regiment nicht einzig aus afro-amerikanischen Soldaten bestanden. Die amerikanische Armeeführung hatte sie nicht kämpfen lassen, weil die meisten weißen Soldaten keine schwarzen Kameraden neben sich wollten. Die Zuordnung zur französischen Armee war aus denselben Gründen erfolgt. Als das 369. Infanterie-Regiment im Februar 1919 nach New York zurückkehrte, wurden die Harlem Hellfighters, wie sie jetzt genannt wurden, mit einer großen Parade gefeiert. Die Soldaten hatten etliche Orden erhalten, einige von der amerikanischen, die meisten aber von der französischen Regierung. Die Harlem Hellfighters standen forthin für die gespaltene Politik der Vereinigten Staaten, in der schwarze Offiziere und Soldaten in Europa für die Freiheit und für ihr Land kämpften, sich aber zu Hause und selbst innerhalb der Armee dem alltäglichen Rassismus zu beugen hatten.
Die Harlem Hellfighters besaßen eine Marschkapelle. Der schwarze Bandleader James Reese Europe hatte 1910 in New York den Clef Club gegründet, eine Art Interessenvertretung für Afro-Amerikaner im Musikgeschäft. Er war erfolgreich, organisierte 1912 ein Konzert des Clef Club Orchestra in der Carnegie Hall und nahm bereits 1913 und 1914 Schallplatten auf, die nicht dem Jazz der Original Dixieland Jazz Band entsprachen, aber ganz gewiss den Geist des Jazz atmeten. Als 1916 das 15. Infanterie-Regiment gegründet wurde, ließ sich Europe anwerben und überzeugte seine Vorgesetzten davon, dass ein