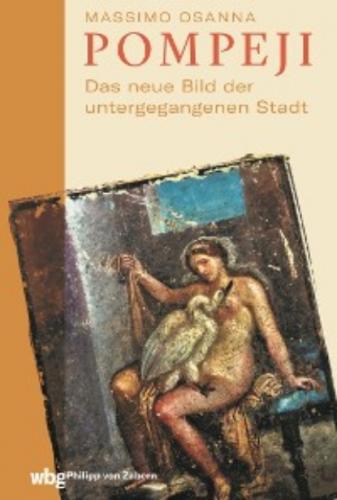Diese „Nicht-Einwohner“, die sich zwischen Mittelitalien und Kampanien bewegten, müssen mit den Einwohnern Pompejis ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und Verbundenheit gemein gehabt haben, das durch gleiche Sprache und Schrift und die Teilnahme an den gleichen Ritualen für die gleichen Götter ihrer (ursprünglichen) Heimat gefestigt wurde. Eine Reihe gemeinsamer kultureller Marker (wie etwa die lokal hergestellten, aber nahezu mit den Bucchero-Gefäßen Etruriens identischen Kelche oder die – von weiter entfernt liegenden Emporien – importierten Objekte, die genauso auch in den Heiligtümern ihrer Heimatstädte als Votive der Allgemeinheit präsentiert wurden) ermöglichten es den Pompejanern und den Fremden aus Etrurien, sich als Angehörige nicht nur ein und derselben ethnischen Gruppierung, sondern auch desselben sozialen Ranges zu fühlen.
Abb. 34 Mi Spuriia[---]. Die fragmentarische Inschrift erinnert an den Namen einer bekannten Familie tarquinischen Ursprungs, die Spuriana. Einige der Opfergaben stammten vielleicht von Reisenden, die Handel trieben und im Heiligtum Station machten. (Archiv PAP)
Wie funktionierte der Ritus?
Wie wurde der zeremonielle Akt durchgeführt? Wozu benutzte man die Gefäße, die von Mamarce und Leθe oder von einem Mitglied der Familien Manile oder Spuriana in das Heiligtum gebracht wurden? Wie wurde der Gegenstand verwendet, nachdem die Formel eingeritzt und deklamiert worden war? Welche Rituale wiederholte man im Heiligtum regelmäßig? Wie wurde die Kommunikation mit den ganz speziellen übermenschlichen Akteuren, die die Götter waren, auf praktischer Ebene aktiviert?19
Natürlich ist es schwierig, einen Ritus zu greifen, ohne ihn je miterlebt zu haben. Problematisch erscheint insbesondere die Rekonstruktion jener bedeutsamen Abläufe, die das Sensorische des Rituals – Sehen, Fühlen und Riechen – betrafen. Sie sind für uns kaum mehr nachvollziehbar. Der archäologische Befund kann jedoch helfen, zumindest bestimmte Ausschnitte der rituellen Handlung zu rekonstruieren, vor allem wenn wir mithilfe neuer Technologien die antiken Artefakte erneut befragen: Naturwissenschaftliche Analysen machen es möglich, eine Geschichte der Gesten und auch einzelne „Objekt-Biografien“ neu zu schreiben.
Die Form des Gefäßes, eines Trinkgefäßes, die häufigen Krüge zum Ausgießen von Flüssigkeiten, die Verortung des Gefäßes im stratigrafischen Kontext oder die Position der Inschriften, die oft nur zu entziffern sind, wenn das Gefäß auf dem Kopf stand: All diese Informationen zusammen geben eine Vorstellung davon, welche Handlungen unsere Akteure innerhalb des Heiligtums (Abb. 35 und 36) vollzogen, nachdem sie es aufgesucht hatten, um ihre Wünsche und Bitten an die Gottheit zu richten. Teil des Rituals war es aller Wahrscheinlichkeit nach, eine Flüssigkeit aus den Kantharoi auf den Erdboden oder ein Feuer, das im Rahmen der Opferzeremonien entfacht worden war, zu gießen. Ein solches Opfer war einer Unterweltsgottheit geweiht, von der man annahm, dass sie im Untergrund ihr Zuhause hatte. Der Kontakt wurde über verschiedene Handlungen hergestellt: rituelle Gesten, Bewegungen, Worte. Die Libation, also das Trankopfer, war dabei von grundlegender Bedeutung. Nach der Flüssigkeit wurde auch das Gefäß – mit der Inschrift, die eingeritzt worden war, um die mit der Gottheit eingegangene Verbindung auf Dauer zu garantieren – als Opfer dargebracht und auf dem Boden abgestellt. Manchmal wurde auch der Krug selbst, aus dem der Wein in die Trinkschalen geschöpft worden war, ehe er daraus auf den Boden oder den Altar gegossen wurde, niedergelegt.20 Die Gesten dürften nach einem ganz bestimmten Kodex ausgeführt und wiederholt worden sein. Die normierten Abläufe ermöglichten das Eintreten in eine Dimension des möglichen und wirkungsvollen Kontaktes mit dem Gott oder der Göttin. Nur so hatten die Bitten eine gute Chance, tatsächlich erfüllt zu werden.21
Was für eine Flüssigkeit genau dargebracht wurde, ist nicht mehr mit Sicherheit zu sagen. Die in den Gefäßen vorhandenen Rückstände wurden von Chemikern mittels Chromatografie analysiert.22 Die Untersuchungen konnten die Verwendung von Traubenderivaten in verschiedenen Gefäßen nachweisen; hauptsächlich handelte es sich um Rotwein, aber auch Rückstände von Weißwein wurden festgestellt. Das Trankopfer bestand demnach in der Regel aus Wein. Allerdings können wir in einigen Fällen nicht ausschließen, dass nicht auch unvergorener Traubensaft mit aromatischen Kräutern versetzt worden ist und dass diese speziellen Gemische bestimmten Momenten des Rituals vorbehalten waren. Die naturwissenschaftlichen Analysen liefern noch weitere interessante Informationen: Üblicherweise hat man die Gefäße vor ihrem Gebrauch wasserdicht gemacht – mittels Tierfett (sowohl von Wiederkäuern als auch von Schweinen), wie zahlreiche Spuren auf den Innenseiten der Gefäße belegen. Reste eines pflanzlichen Öls in einem Trinkbecher aus Bucchero, der in das frühe 6. Jahrhundert v. Chr. datiert wird und Rückstände von rotem Traubensaft enthielt, könnten hingegen ein Hinweis darauf sein, dass man damit den natürlichen Glanz der Gefäßoberfläche noch verstärken wollte.
Abb. 35 Blick von Norden auf die äußere Umfassungsmauer des heiligen Bezirks im Fondo Iozzino. In diesem Areal konnte durch Ausgrabungen zwischen 2014 und 2017 eine beträchtliche Menge von Votivgegenständen aus archaischer Zeit geborgen werden. (Archiv PAP)
Abb. 36 An einigen der gefundenen Gefäße führte man chromatografische Analysen durch, um Informationen über die Opfergaben und Rituale, die im Heiligtum stattgefunden haben, zu gewinnen: Die Gefäße hatten einen wasserundurchlässigen Überzug, was sie für die Aufnahme von Wein geeignet machte, wie er der Gottheit als Trankopfer dargebracht wurde. Dieser war gewöhnlich aromatisiert und mit verschiedenen Essenzen angereichert.
Der Rotwein wurde mit Harzen (beispielsweise von Nadelbäumen) oder anderen pflanzlichen Essenzen aromatisiert, wie es auch in der griechischen Welt üblich war. Eine Weinkanne (olpe) und ein größerer Kochtopf (olla) weisen zudem Rückstände von etwas auf, das wir als eine Art medizinische Rezeptur bestimmen konnten: Reste eines Krautes aus der Familie der Asteraceae, wahrscheinlich die in den antiken Quellen erwähnte Euphorbia.23 Diese Pflanze wird wegen ihrer antibakteriellen, antiviralen,