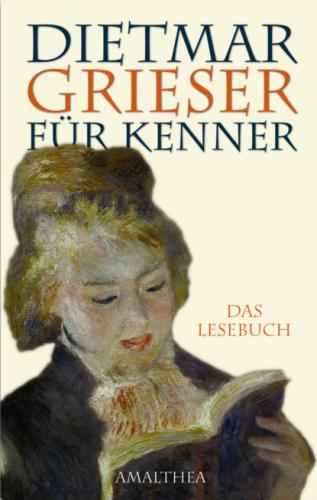Im vorigen Jahrhundert war das anders. Wer als Liliputaner oder als siamesische Zwillinge auf die Welt kam, hatte, sofern ihnen überhaupt ein dauerhaftes Leben beschieden war, nur die Wahl, vor einer grausam-spöttischen Mitwelt versteckt oder aber im Gegenteil für klingende Münze von ihr bestaunt zu werden. In diesem Fall kam es darauf an, was der Betreffende aus seinem Handicap zu »machen« verstand. Dann freilich war das Publikum sogar bereit, von Verachtung oder Mitleid auf Bewunderung umzuschalten, und aus dem Krüppel wurde ein für seine Willensstärke und Kunstfertigkeit gefeierter Held.
So einer – und einer der Erfolgreichsten und Berühmtesten seiner Art – war der »Rumpfmensch« Nikolai Basilowitsch Kobelkoff. Und Wien war der Ort, an dem er jenes Zipfelchen Glück fand, das auch diesem zutiefst Bedauernswerten das Leben lebenswert machte …
Die Kobelkoffs sind im russischen Gouvernement Cherson daheim. Troizk heißt das Dorf im Kreis Wosnessensk, wo der Vater Kosakenhauptmann und Bürgermeister ist. Das Geld, das er für den Unterhalt seiner vielköpfigen Familie braucht, verdient er in einem nahen Goldbergwerk. Von den fünfzehn Kindern, die seine Frau Natalie zur Welt bringt, sind vierzehn ganz normal gewachsen – nur Nikolai, geboren am 22. Juli 1851, schlägt aus der Art. Die Hebamme bringt es nicht über sich, der jungen Mutter das Neugeborene zu zeigen: Es hat weder Arme noch Beine. Doch der Krüppel, sonst von durchaus kräftiger Statur, überlebt. Die Frauen im Dorf, die von der Mißgestalt wissen, schlagen verängstigt das Kreuz, wenn sie ihrer ansichtig werden: Das kann doch nur eine Ausgeburt der Hölle sein.
Zweierlei hat Nikolai mit auf den Lebensweg bekommen, was ihn in den Stand setzt, seine körperliche Unzulänglichkeit zu überwinden: eine enorme Vitalität und einen unbändigen Trotz. Schon der Zweijährige überrascht seine Eltern mit Versuchen, auf seinen Beinstümpfen laufen zu lernen, und indem er bei Tisch das Besteck geschickt zwischen Wange und Armstumpf klemmt, gelingt es ihm mit der Zeit sogar, das Essen zu zerteilen und zum Mund zu führen. Beim An- und Auskleiden nimmt er die Zähne zu Hilfe.
Als Nikolai zehn ist, kann man den Versuch wagen, ihn zur weiteren Ausbildung dem Popen von Tobotiz anzuvertrauen: Unter dessen geduldiger Anleitung lernt er schreiben, Papier schneiden, nähen. Auch beim Fischen und auf der Jagd wird er später seinen Mann stellen; das Dreigespann lenkt er, indem er die Zügel um den Nacken schlingt; mit dem Halsmuskel und dem aus der rechten Achselhöhle ragenden Armstummel ersetzt er, was ihm die Natur an Greifwerkzeug vorenthalten hat.
Das Wunder wird wahr: Nikolai kann mit achtzehn ins Berufsleben eintreten, Vater Kobelkoff verschafft ihm eine Stelle als Schreiber im selben Goldbergwerk, in dem auch er beschäftigt ist. Man vertraut ihm die Führung der Lohnlisten an, dank seiner gestochen klaren Handschrift wird er auch zur Korrespondenz mit herangezogen.
Die für sein weiteres Fortkommen entscheidende Begegnung hat Nikolai jedoch auf einem der Jahrmärkte der Gegend: Ein Moskauer Menagerieunternehmer namens Berg kann den inzwischen Zwanzigjährigen dazu überreden, aus der Not eine Tugend zu machen und sein Glück als Schaubudenattraktion zu versuchen. Er verläßt das Elternhaus und zieht fortan als »Rumpfmensch« von Stadt zu Stadt. Achtzig Zentimeter groß und sechzig Kilo schwer, zeigt er vor zahlendem, zwischen Mitleid, Staunen und Bewunderung schwankendem Publikum seine makabren Künste: läßt sich im Kostüm des Uralkosaken auf die Bühne hinaustragen, produziert sich als Schnellzeichner, schneidet Silhouetten, zielt mit der Flinte auf die Schießscheibe, zeigt, wie man ohne Arme Nähnadeln einfädelt, kutschiert einen Ponywagen und läßt sich ein Brett auf die Schultern legen, auf dem er spielend drei ausgewachsene Männer balanciert. Der Höhepunkt der Darbietung ist jedesmal erreicht, wenn Nikolai Leute aus dem Publikum auf die Bühne bittet und eine Prämie für denjenigen aussetzt, der es schafft, ihn dreimal vom Boden aufzuheben. Zweimal gelingt es allen, beim drittenmal keinem: So athletisch stemmt sich das bißchen Körper gegen den beherzten Zugriff. In späteren Jahren werden auch noch ein Entfesselungsakt und eine Nummer im Löwenkäfig dazukommen.
Bis zu fünfzigmal am Tag verwandelt sich der Krüppel, dessen Bettstatt die Maße einer Wiege hat und dessen Fahrzeug ein dreirädriger Kinderwagen mit dichtgeschlossenem Vorhang ist, in einen Artisten der Sonderklasse. Kasan, Moskau, St. Petersburg, Odessa, Wilna, Warschau und Kiew – überall strömt ihm das Rummelplatzpublikum zu, und bald wird er sogar die Grenzen des Zarenreichs überschreiten und auch in Damaskus und Jerusalem auftreten, in Suez und Konstantinopel, und als er 1875, nun in Skandinavien und Deutschland unterwegs, die Bekanntschaft des führenden Praterunternehmers August Schaaf macht, holt ihn dieser nach Wien.
Nikolai Basilowitsch Kobelkoff ist nun vierundzwanzig, also in dem Alter, wo andere heiraten. Aber für eine Mißgeburt seines Schlages kommt so etwas natürlich nicht in Betracht. Wie sollte ein Mann wie er eine Frau glücklich machen? Und gar eine Familie gründen?
Doch das Unglaubliche tritt ein: Anna Wilfert, sechs Jahre jünger als er, Tochter eines aus Deutschland zugewanderten Geometers und Schwägerin des Praterunternehmers August Schaaf, ist nicht nur bereit, sondern gegen alle Widerstände von außen fest entschlossen, dem Werben des »Rumpfmenschen« nachzugeben und mit ihm in den Stand der Ehe zu treten. Ein Krüppel, der noch dazu kaum ein Wort Deutsch spricht – die Eltern der Braut können einen solchen Heiratsantrag nur als freche Zumutung zurückweisen. Auch der Pope, der die Trauung vornehmen soll, gibt sich entrüstet: Da aus einer solchen Ehe niemals Kinder hervorgehen können (und dürfen), wäre sie in seinen Augen eine glatte Gotteslästerung. Außerdem ist die Braut nicht willens, zum russischorthodoxen Glauben zu konvertieren.
Ein zweiter Versuch – diesmal in Dresden – schlägt gleichfalls fehl. Erst beim dritten hat man Glück: Ein evangelischer Pastor in Budapest erklärt sich bereit, Nikolai und Anna den kirchlichen Segen zu erteilen, und so tritt das ungleiche Paar im Jahr darauf in der Deak-Kirche zu Pest vor den Altar. Es wird ein Trauungsakt, wie ihn die Welt kaum je gesehen hat: Die Braut in Myrtenkranz und Schleier trägt den Bräutigam auf ihren beiden Armen zum Altar, mit den Zähnen steckt er ihr den Ehering an, er selber wird den seinen zeitlebens in einem ledernen Etui tragen, das ihm um die Brust hängt.
Von Wien aus zieht Nikolai Basilowitsch Kobelkoff nun zu seinen weiteren Auftritten von Stadt zu Stadt, von Land zu Land – und seine junge Frau mit ihm: als Gefährtin und Impresario. In nicht weniger als sieben Sprachen kann er sich mittlerweile verständigen. 1882 wird der amerikanische Zirkus Barnum & Bailey auf ihn aufmerksam und nimmt ihn für einige Jahre unter Vertrag. In Wien noch für 10 Kronen auftretend, scheffelt Kobelkoff nun das große Geld und kann somit jenen Grundstock anlegen, den er, wenn er 1901 endgültig zurückkehrt und für Österreich optiert, brauchen wird, um sich mit eigenen Unternehmen im Prater niederzulassen.
Vorher aber wird ein weiteres – und vielleicht das größte aller Wunder Wirklichkeit: Kobelkoff. der »Rumpfmensch«, wird Vater! Sechs gesunde Kinder von durchwegs normaler Statur bringt Anna ihrem Mann zur Welt – und wie es sein Beruf mit sich bringt: jedes an einem anderen Ort. Wo man halt gerade im Engagement ist. Im Wohnwagen des fahrenden Volks, auf Jahrmärkten, hinter Zirkuszelten. Und was den stolzen Vater vollends glücklich macht: Sämtliche sechs Sprößlinge – fünf Söhne und eine Tochter – steigen ins elterliche Metier ein, werden Schausteller. Sohn Paul im Pariser Lunapark, alle anderen in Wien.
Als am 29. Mai 1912 – mehr als zwanzig Jahre vor ihrem Mann – Anna Kobelkoff stirbt, ist ein nicht geringer Teil des Wurstelpraters – Tobogan und Velodrom, Schweinchenkarussell und Wachauerbahn – in der Hand der Kobelkoff-Dynastie, und der Stammvater kann sich endlich von der Bühne zurückziehen und zur Ruhe setzen. Und den Zeitungsleuten, die wieder und wieder bei ihm anklopfen, von seinem schweren, aber durchaus auch freudenreichen Leben erzählen, das ihm damals, als er 1851 als elender Krüppel zur Welt kam, wohl niemand vorauszusagen gewagt hätte. Wer hat ihm nicht alles im Lauf der Jahre für seine Kunststücke applaudiert: Zar Alexander II., König Albert von Sachsen, Königin Wilhelmina von Oranien, der preußische Thronfolger, Reichskanzler Bismarck, Kronprinz Rudolf in Wien.
1899 druckt das »Illustrierte Wiener Extrablatt« den »Roman des Rumpfmenschen«, in Frankfurt erscheint die Buchausgabe: »Beschreibung und Biographie des wunderbarsten Phänomens